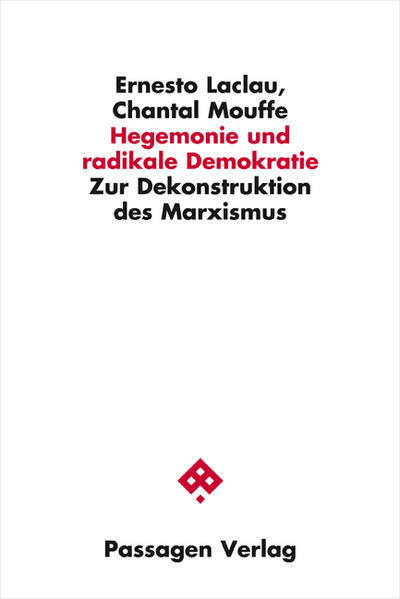Die Stunde der Eggheads
Matthias Dusini in FALTER 14/2015 vom 01.04.2015 (S. 24)
Theorie ist wieder da: Griechenlands linker Finanzminister Yanis Varoufakis macht das Erbe von Marx und Freud wieder hip. Krieg und Armut steigern die Nachfrage nach radikalen Thesen. Zwischen Pastrami-Sandwich und Caffè Latte tauchen auch im reichen Mitteleuropa wieder die Theoriebände von Merve und Suhrkamp auf
Der Listenreiche steckt das Hemd nicht in die Hose und vergleicht den Kapitalismus mit der Büchse der Pandora. Seine europäischen Kollegen ermüdet der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis, mehr Kopf als Zahl, mit langatmigen Exkursen. Seitdem der Odysseus der Neoliberalismuskritik in Europa umgeht, sind Begriffe wie Hegemonie und Diskursanalyse wieder sexy. Mit Varoufakis und der regierenden Syriza-Partei kehrt ein Akteur in die politische Arena zurück, der seit Jahrzehnten verschwunden war – der Theoretiker. The egghead is back.
Theorie, dieses Zauberwort intellektueller Distinktion, begann im versteinerten Konsens der Nachkriegszeit abweichlerisch zu funkeln. Nach Jahren im Exil stürmten Remigranten wie Theodor W. Adorno die öffentlichen Debatten. Adornos dunkler, aphoristischer Stil brachte einen neuen Sound in die Philosophie.
Italienische Querdenker entwickelten in den späten 1960er-Jahren ein linksradikales Vokabular jenseits der Kampfrhetorik kommunistischer Parteikader. Und in Frankreich feierten Hochschulabsolventen die als faschistoid geltenden Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger als Träger eines magischen Wissens.
Wie rare Bootlegs wanderten die Taschenbücher der Verlage Merve und Suhrkamp von WG zu WG. „Theorie war mehr als eine Folge bloßer Kopfgedanken“, schreibt der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch in seinem wunderbaren Buch über den „Langen Sommer der Theorie“. „Sie war ein Wahrheitsanspruch, ein Glaubensartikel und ein Lifestyle-Accessoire.“
Seit der Finanzmarktkrise 2008 nimmt das Interesse an den Bleiwüsten spürbar zu. Voreilig hatten die Vertreter des „Kapitaloparlamentarismus“ (Alain Badiou) das wirtschaftsliberale Happy End nach dem Scheitern des Kommunismus verkündet. Armut und Krieg bestimmen das Bild der Gegenwart und steigern die Nachfrage nach radikalen Thesen. Die Idee eines auf Globalisierung und Digitalisierung beruhenden Fortschritts hat seine dogmatische Kraft eingebüßt.
In Italien versammeln sich Netzaktivisten, Umweltschützer und arbeitslose Akademiker um den ehemaligen Satiriker Beppe Grillo, dessen 5-Sterne-Bewegung von dem Medientheoretiker Gianroberto Casaleggio dirigiert wird. Casaleggio will die repräsentative Demokratie der Parteien und Kammern zugunsten einer horizontalen Web-Demokratie abschaffen.
In den von Sparprogrammen ausgezehrten Ländern Südeuropas haben die Ideen des Gemeinguts Konjunktur. Selbstorganisierte Bauern, Lehrer und Ärzte streben ein alternatives Lebensmodell an, ähnlich dem von Jean-François Lyotard im Jahr 1977 skizzierten „Patchwork der Minderheiten“. Theoretisch war schon damals klar: Nicht die Arbeiterklasse ist die treibende Kraft der Veränderung, sondern das Lumpenproletariat der Schwarzarbeiter, Migranten und „Präkarisierten“, wie die neueste Linke Menschen ohne fixen Job bezeichnet.
Seit 1. September 2014 wird Attika von einer Theoretikerin regiert. Da übernahm Rena Dourou die Präfektur der Region rund um Athen. Dourou gehört wie Finanzminister Varoufakis und der Ökonom Costas Lapavitsas zur Führungsriege von Syriza (deutsch: Koalition der Radikalen Linken); alle drei haben in England studiert. Eine Keimzelle des revolutionären Denkens ist das Institut für Politische Theorie der Universität von Essex, wo Dourou ihren Abschluss mit einer Arbeit über Ideologie und Diskursanalyse machte.
Das Syriza-Konzept einer pluralen Demokratie stammt von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, den Gründern der Essex-Schule. Deren Hauptwerk „Hegemonie und radikale Demokratie“ lässt sich als Programm für einen linken Populismus interpretieren, der die Sehnsucht der Menschen nach Identität berücksichtigt. Von Mouffe und Laclau haben die Radikalen gelernt, dass man zu unorthodoxen Allianzen bereit sein muss: Koalitionspartner von Syriza ist die rechtspopulistische Anel-Partei.
Und im wohlhabenden Mitteleuropa? Auf den Coffee-Tables blitzen zwischen Pastrami-Sandwich und Caffè Latte vermehrt wieder Theoriecover auf. Auch auf der Straße artikuliert sich die Solidarität mit den griechischen und spanischen Empörten, den Indignados. Anlässlich der Eröffnung des Sitzes der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main gingen unlängst Zehntausende auf die Straßen.
Eine Multitude aus Gewerkschaftern, antirassistischen und feministischen Gruppen demonstrierte gegen das „Elend der Austerität“. Multitude, „Multitüd“ mit Akzent auf der letzten Silbe ausgesprochen, ist ein von Toni Negri und Michael S. Hart in dem Buch „Empire“ entwickelter Begriff, der ein buntes Oppositionsbündnis bezeichnet. Die Augen des inzwischen 81-jährige Toni Negri leuchten gefährlich. So wie damals, Anfang der 1970er-Jahre, als er junge Fiat-Arbeiter vom bewaffneten Kampf gegen das Schweinesystem überzeugte, der manchmal mit Tod oder Gefängnis endete.
Anders als im goldenen Zeitalter der Theorie ist der Lesestoff verfügbar. In den 70ern zirkulierten Raubdrucke, stellten Autoren wie Lyotard ihr geistiges Eigentum den Genossen kostenlos zur Verfügung. Heute stellen ambitionierter Kleinverlage wie Orange-Press, Merve, Turia + Kant oder Matthes & Seitz ihre Reader ins Netz. Früher nickten die Eingeweihten wissend, wenn sie beim Beislpalaver die Namen hipper penseurs hörten. Im globalisierten Verlagswesen erscheinen die Interviews der Kritik-VIPs wie Slavoj Žižek in mehreren Sprachen, reißen sich große Medienhäuser um die Manuskripte.
Allzu ausführlich sollten die Zündkerzen der Revolte in diesen ungeduldigen Zeiten nicht sein. Die neuen Buchreihen edition suhrkamp digital und Fröhliche Wissenschaft (Matthes & Seitz) liefern die Injektion für Zwischendurch. Stéphane Hessels Streitschrift gegen die Herrschaft des Geldes „Empört euch!“ hat keine 20 Seiten, Byung-Chul Hans apokalyptisches Pamphlet „Transparenzgesellschaft“ keine 100.
Der Durchbruch der Theorie um 1990 war gleichzeitig das Ende ihrer heißen Phase 1968ff. Nun eroberte die subversive Denkschule des Poststrukturalismus auch die deutschsprachigen Universitäten. Nun konnte man Dissertationen über den „mystischen Grund der Autorität“ schreiben, wie ein einschlägiger Titel des Theoretikers Jacques Derrida heißt, ohne der Rechtslastigkeit verdächtigt zu sein.
Innerhalb der Universitäten stiegen „Derridada“ und „Lacancan“, so spöttische Bezeichnungen für das oft unverständliche Idiom französischer Philosophen, zum Mainstream auf. Außerhalb verblasste Subversion zum Alleinstellungsmerkmal von Kunstbuchhandlungen, überwinterte in den geschützten Werkstätten der Akademien und Biennalen.
In den Kunstinstitutionen ist das wilde Denken nach wie vor verankert. Die Akademien stehen freien Radikalen offen, die auf dem Marsch durch die Diskursplattformen mitunter den Studienabschluss vergessen haben. Die Distanz zum wissenschaftlichen Normalbetrieb gehört zum Selbstverständnis der Antidogmatiker: Auf Wiener oder Londoner Akademien fanden Querdenker wie Diedrich Diederichsen oder Mark Fisher (siehe auch S. 26) einen Platz am Rande des Establishments. Der Franzose Jacques Rancière, dessen Erörterungen über den „Anteil der Anteillosen“ hart zu knackende Nüsse sind, wird auf film- und kunstwissenschaftlichen Symposien gefeiert. Der etwas schrullige Diskursveteran gehört zu jenem Orden, dessen Autorität auch darauf beruht, dabei gewesen zu sein. Der Pariser Mai 1968 ist noch immer das Paradebeispiel für die Vereinigung von Kopf und Kampf.
Das Diskutieren leninistischer Grundlagentexte wurde damals zur „theoretischen Praxis“ verklärt, der Theoretiker zum Arbeiter im Weinberg des Herrn Marx. Auf Lenins Frage „Was tun?“ hatten die Kinder der Nazieltern vor allem eine Antwort: „Lesen!“ Langhaarige Spontis traten in den Berliner und Wiener Wohngemeinschaften zur Selbstkritik vor dem Kollektiv an und setzten das angelesene psychoanalytische Wissen zaghaft in die Praxis freier Liebe um. Make Lesekreis, not war!
Die dick unterstrichenen und mit Anmerkungen versehenen Suhrkamp-Bändchen sind die Signatur einer Epoche, der „Suhrkamp-Kultur“. „Die ganze Beweisführung von Engels hängt in der Tat an diesem ganz besonderen Gegenstand, d.h. an den individuellen Willen, die im physikalischen Modell des Kräfteparallelogramms zueinander in Beziehung gesetzt sind“, schreibt Louis Althusser in seinem Klassiker „Für Marx“.
Die Klasse von 68 kommt auch heute wieder in Fahrt, wenn das Kentern des Kapitalismus zur Diskussion steht. David Harvey, Jahrgang 1935, gilt als Vordenker neomarxistischer Stadtplanung. In seinem neuen Buch „Siebzehn Widersprüche und das Ende des Kapitalismus“ plädiert er für einen revolutionären Humanismus.
Und wenn Alain Badiou, Jahrgang 1937, sich auf seine Jugend im Maoismus zurückbesinnt, gilt das nicht als Zeichen von Senilität, sondern als revolutionärer Leistungsnachweis. Alte, weiße Männer sind in gendersensibler Umgebung das Symbol für die Fortdauer des heteronormativen Regimes. Im Kampf gegen den Neoliberalismus machen die greisen Marx Brothers Boden gut.
Und auch der Motorradfahrer Yanis Varoufakis entspricht nicht dem Klischee des sensiblen, zwischen den Identitäten changierenden Subjekts, das mit der Gendertheorie populär wurde. Den queeren Unterstrich_Amazonen folgt die geballte Faust – der Egghead mit Eiern.