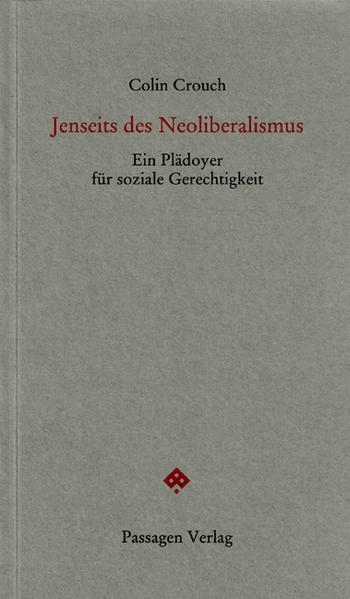"Der roten Ministerin gönnen wir diesen Erfolg nicht"
Barbaba Tóth in FALTER 26/2013 vom 26.06.2013 (S. 16)
Er ist einer der spannendsten Vordenker der Linken, sie kämpft für eine Schulreform. Der Soziologe Colin Crouch und Bildungsministerin Claudia Schmied erzählen, was sie voneinander lernen
Claudia Schmied sagt "Colin", und Colin Crouch sagt "Claudia". Die österreichische Bildungsministerin und der britische Soziologe, der mit seiner Beschreibung der "Postdemokratie" weltberühmt wurde, kennen und schätzen einander seit mehreren Jahren. Für den Falter kommen sie zu einem Gedankenaustausch über Crouchs neues Buch zusammen.
Falter: Was können eine Ministerin und ein Soziologe voneinander lernen?
Claudia Schmied: Viel. Ist es nicht interessant, dass derzeit viel mehr Impulse für Politiker von Soziologen als von Ökonomen kommen? Soziologen haben heute den erzählenden, beschreibenden, gesamthaften Anspruch, den früher Nationalökonomen wie ein Joseph Schumpeter oder ein Friedrich Hayek hatten. Ökonomen sind auf Mikroebenen unterwegs, viel zu finanzmathematisch und formelmäßig.
Colin Crouch: Claudia, ich hoffe, du hast recht. Aber auch wir Soziologen vertiefen uns oft sehr in unsere Fachthemen. Dann sind wir unfähig, uns mit der Politik auszutauschen. Ich war immer sehr daran interessiert, für meine Ideen den Praxisbezug zu finden.
Herr Crouch, eine Postdemokratie ist eine Demokratie, in der die Macht nicht mehr in den Händen der Politik, sondern der Unternehmen liegt. Wie postdemokratisch ist Österreich?
Crouch: Derzeit noch weniger als viele andere Länder, weil Österreich klein ist und das Beziehungsgeflecht zwischen Politik und Wirtschaft eng. Aber das Risiko, postdemokratisch zu werden, ist da. Auch in Österreich haben die neuen sozialen Schichten der postindustriellen Revolution keine authentische politische Stimme gefunden. Klassische Parteien verstehen sie nicht mehr. Und die Globalisierung hat natürlich auch Österreich erfasst.
Schmied: Ich stimme dir zu. Der Trend in Richtung Postdemokratie ist bei uns eher gebremst. Wichtig ist dafür auch, dass sich die SPÖ mit der Gewerkschaftsbewegung versöhnte. Das war ein wichtiger Schritt Werner Faymanns, sein Vorgänger Alfred Gusenbauer war da eher auf Distanz.
Herr Professor, in Ihrem neuen Buch stellen Sie sich die Frage, wie der Trend zur Postdemokratisierung überwunden werden kann. Die Sozialdemokratie ist gefordert. Sie muss den Wohlfahrtsstaat zu einem Staat der sozialen Investitionen machen, im Einklang mit dem Markt, nicht gegen ihn, lautet Ihr Rezept.
Crouch: Die Sozialdemokratie ist einfach die innovationsfreudigste Bewegung im politischen System. Sie kann es aus dem Inneren heraus erneuern.
Schmied: Und ich als Sozialdemokratin habe jetzt folgendes Dilemma: Die österreichischen Gewerkschaften haben das Wettbewerbsprinzip im Unternehmertum innerhalb der Marktwirtschaft akzeptiert. In der Finanzkrise waren sie etwa bereit, auf Kurzarbeit einzugehen. Gleichzeitig ist ein erstklassiger öffentlicher Sektor, gerade als Antwort auf die Finanzkrise, so wichtig wie noch nie.
Crouch: Das ist meine zentrale These.
Schmied: Aber wie schaffen wir es, dass öffentliche Dienste, also Schulen oder das Gesundheitssystem, innovativ, effektiv und wettbewerbsorientiert auftreten, ohne dass wir den Druck des Marktes haben? Das ist meine große Herausforderung. Denn Bildung ist ein wichtiges öffentliches Gut. Aber gerade Vertreter der Lehrergewerkschaft gehören nicht zu den innovationsfreudigsten.
Dort wurde Herrn Crouchs neues Buch noch nicht gelesen?
Schmied: Nein, offenbar nicht. Und das ist genau das Problem. Ich nehme diese Gewerkschaft sehr stark als Standesvertretung wahr. Colin, du musst wissen, wir sind seit Jahren in schleppenden Verhandlungen für ein neues Dienst- und Besoldungsrecht. Mehr Leitungsverantwortung, mehr Dienst an der Schule. Wir diskutieren über Gehälter und Unterrichtsverpflichtungen, in Wahrheit sollten wir aber über die Zukunft der öffentlichen Schulen reden. Denn wenn es uns nicht gelingt, sie auf Topstandard zu bringen, arbeiten wir dem Neoliberalismus in die Hände. Weil wir den Menschen dann unfreiwillig Argumente liefern, warum eine Privatschule besser wäre.
Crouch: Eine Reform kann nur funktionieren, wenn alle zusammenarbeiten.
Schmied: Das setzt voraus, dass alle wollen. Aber wir haben Dienstnehmer- und Dienstgeberinteressen, dazu kommt noch das Beharrungsvermögen vieler Lehrergewerkschafter. Und es wird alles auch noch parteipolitisch überlagert, weil diese Gewerkschaft – wie die des öffentlichen Dienstes insgesamt – ÖVP-dominiert ist. Zwischendurch hört man dann auch den Satz: "Der roten Ministerin gönnen wir diesen Erfolg nicht."
Crouch: Wirklich?
Schmied: Ja, und dein Buch hilft mir, diesen Konflikt gerade in Verhandlungssituationen gesamthafter zu sehen. Aus der tiefen Überzeugung heraus, dass ein erstklassiger öffentlicher Sektor unabdingbar ist – mit erstklassigen öffentlichen Gütern.
Crouch: Mehr kann man als Soziologe nicht tun. Ideen liefern, Perspektiven. Das Interessenmanagement muss die Politik leisten. Da bin ich dann wieder ganz Soziologe und schaue zu.
Herr Professor, Sie analysieren die Finanzmarktkrise als Vertrauenskrise. Standeskodex und Handschlagqualität galten nicht mehr. Toxic Papers war ein Schlagwort dazu. Gibt es Toxic Papers nicht auch schon längst in der Politik, Frau Ministerin?
Schmied: Das sind Haltungsfragen. Das Ausmaß der Verwahrlosung nimmt tendenziell leider zu. Beispiel Dienstag vor einer Woche: Am Vormittag proklamiert die Koalition noch gemeinsam das neue Familienpaket. Am Nachmittag wird einem eine Unfreundlichkeit nach der anderen ausgerichtet. Beim Lehrerdienstrecht war es genauso. Zum Wahltermin hin wird sich das noch verschlimmern. Das ist wirklich beklagenswert. Regierungspolitik – das ist auch die Würde der Funktion, des Amtes. Das hat mit Ehrlichkeit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Handschlagqualität zu tun. Das fordere ich dringend ein.
Herr Professor, so gesehen sind wir ja schon mitten im postdemokratischen Wahlkampf angelangt, wie Sie ihn beschrieben haben. Als "reines Spektakel", in dem "konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe" steuern.
Crouch: Wir sehen diese Tendenzen leider in fast allen Ländern.
Schmied: Natürlich hängt das auch mit der medialen Rezeption zusammen. Wenn ich mit meinem Ministerkollegen Karlheinz Töchterle von der ÖVP einen Konflikt habe, lande ich auf der Titelseite. Einige ich mich, ist es bestenfalls eine Kurzmeldung. Schriller, verkürzter, dramaturgisch zugespitzt – das ist prinzipiell dialogfeindlich. Wenn ich unterschiedliche Meinungen nicht mehr austauschen kann, ohne dass daraus ein Konflikt inszeniert wird, wird es auch in einer Demokratie schwierig.
Herr Crouch, der aktuelle Wahlkampf der SPÖ zielt stark auf eine Millionärssteuer ab – und damit auch auf Neid. Sollte die SPÖ nicht mehr Kraft für ihre Vision einer egalitären Gesellschaft investieren?
Crouch: Sie haben absolut recht. Den Wahlkampf nur über Steuerthemen zu führen ist zu wenig. Dass man will, dass Reiche Steuern bezahlen – okay. Es ist eine Schande, ein Skandal und inzwischen auch ein internationales Thema geworden, dass sie es zu wenig tun. Aber wofür sollen sie zahlen? Es braucht eine Vision, den großen Kontext, wohin die Gesellschaft sich bewegen soll.
Schmied: Ich verstehe dich sehr gut. Es fehlt an Erzählungen. Nicht nur in der Politik, auch in der Unternehmenswelt. Es wird von Return on Equity berichtet, aber nicht von den Produkten. Wir brauchen eine empathische Verbindung mit dem, was wir tun. Diese große Grundgeschichte, die Antwort, warum wir tun, was wir tun, die müssen wir neu schreiben, gerade als Sozialdemokratie.
Es gab einmal einen SPÖ-Chef namens Alfred Gusenbauer, der dafür beschimpft wurde, dass er von der solidarischen Hochleistungsgesellschaft sprach. Aber zumindest war es ein Erzählansatz.
Schmied: Richtig. Alfred Gusenbauer wurde dafür heftig kritisiert. Vielleicht nennen wir es lieber solidarische Leistungsgesellschaft. Denn auch für mich ist das kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Wir brauchen Leistung genauso wie Gewinn in einer Marktwirtschaft; gleichzeitig brauchen wir ein soziales Gewissen. Die Neoliberalen wollten uns immer einreden, dass man beides trennen kann. In Oliver Stones "Wall Street" sagt der Investmentbanker zum jungen Broker: "Wenn du einen Freund suchst, kaufe dir einen Hund." Ich liebe diese Szene, weil es das pathologische Prinzip des Neoliberalismus so gut zeigt.
Abschließend, Herr Crouch: Sie sind Kanzler, nicht für einen Tag, sondern für eine Legislaturperiode. Was tun Sie?
Schmied: Ich kann dir Vorschläge machen. Wir brauchen einen Schwerpunkt beim Erarbeiten von Selbstbewusstsein. Wir müssen Freude am Erfolg lernen. Zuversicht.
Crouch: Es braucht eine Alternative zum Neoliberalismus, und die Sozialdemokratie muss sie finden.
Und Sie, Frau Ministerin? Träumen Sie nicht manchmal von einer anderen Lehrergewerkschaft?
Schmied: Nein, Politik ist die Arbeit am Status Quo für eine bessere Zukunft.