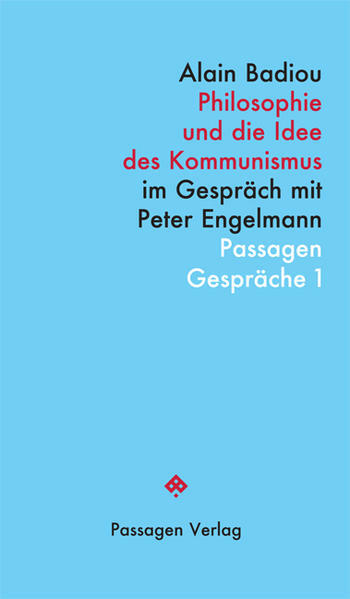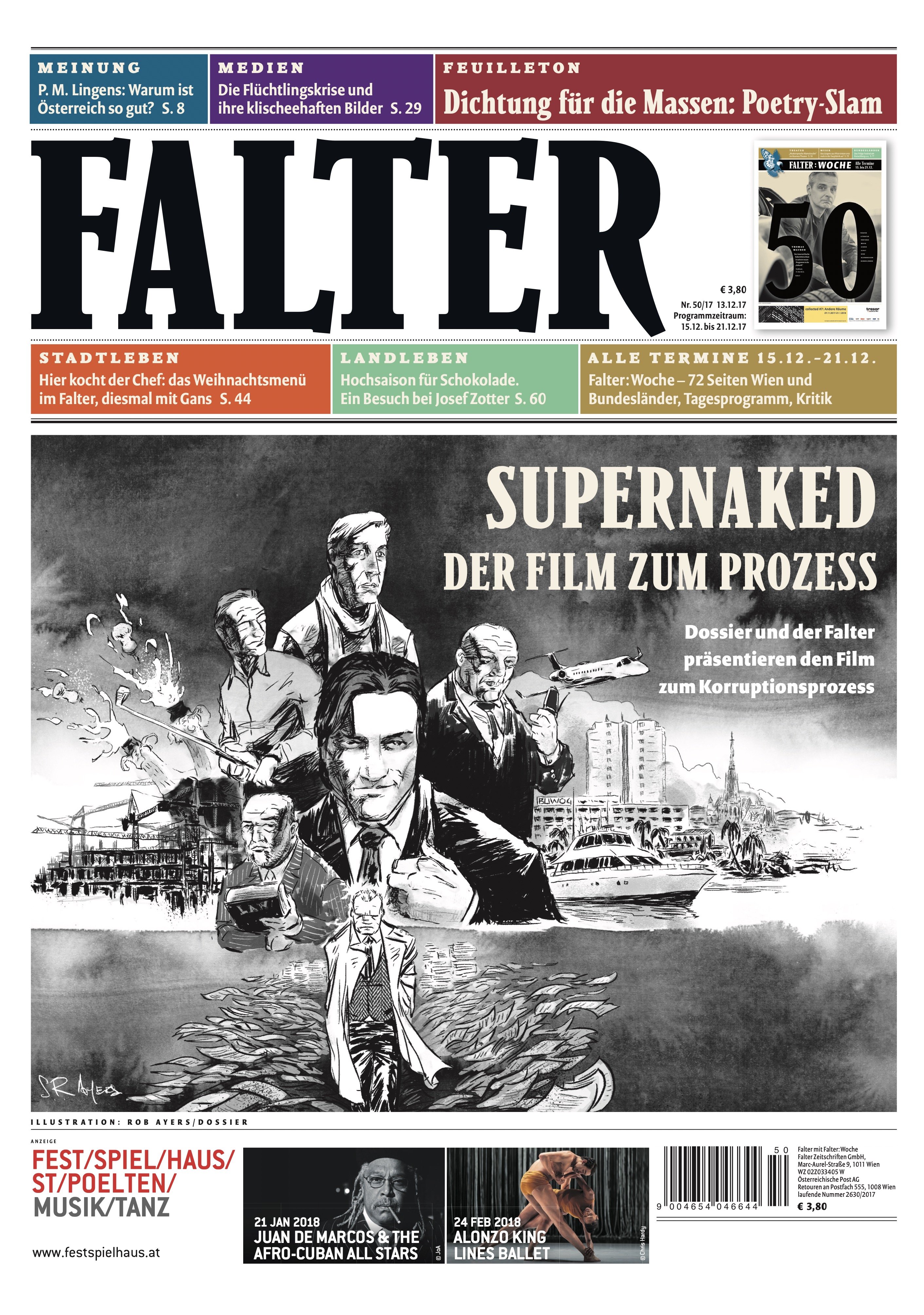
„Wir müssen die Welt, wie sie ist, ablehnen“
Matthias Dusini in FALTER 50/2017 vom 13.12.2017 (S. 40)
Der französische Philosoph Alain Badiou schwenkt noch immer die rote Fahne der Revolution. Warum?
Überall, wo der Theoretiker Alain Badiou, 80, auftritt, füllt er die Säle. Über die Jahrzehnte hinweg blieb er dem Kommunismus treu, und die Nachfrage nach linken Lehren ist wieder groß. Badiou studierte beim marxistischen Vordenker Louis Althusser und engagierte sich nach 1968 für den Maoismus. Unlängst weilte er in Wien, um seine Schriften zu präsentieren. Bei dieser Gelegenheit sprach er über die Bedeutung der Oktoberrevolution, der der Falter heuer eine Serie gewidmet hat. Mit dabei war auch seine Lebensgefährtin Cécile Winter, die Badious Antworten immer wieder ergänzte.
Falter: Herr Badiou, vor 100 Jahren fand die Oktoberrevolution statt. Was hat dieses Ereignis in Ihrem Leben bedeutet?
Alain Badiou: Die Oktoberrevolution hat in meiner Kindheit keine Rolle gespielt. Meine Familie war sozialdemokratisch, nicht kommunistisch. Daher war auch der Oktober 1917 nichts Außergewöhnliches oder Heldenhaftes. Richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe ich mich erst Anfang der 60er-Jahre. Ich habe damals die École normale supérieure besucht, wo Louis Althusser unterrichtet hat. Das war der Beginn meiner Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Fast noch wichtiger für die Entwicklung meines politischen Bewusstseins war aber der Algerienkrieg.
Warum?
Badiou: Als 1954 der bewaffnete Aufstand gegen das französische Kolonialregime begonnen hat, war die öffentliche Meinung mehrheitlich für den Krieg. Ich habe zu jener kleinen Minderheit gehört, die dagegen war. Das war mein erster Bruch mit den herrschenden Verhältnissen und der Beginn meines Engagements gegen den Kolonialkrieg. Die chinesische Kulturrevolution einige Jahre später war für mich ebenfalls sehr wichtig. Diese beiden Ereignisse sind auch der Grund dafür, dass ich nie ein klassischer europäischer Kommunist war, sondern mich immer auch mit dem Kolonialismus beschäftigt habe.
Finden Sie die Revolution gut oder schlecht?
Badiou: Sie war ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der Menschheit, weil sie den Versuch darstellt, die alte Welt zu zerstören und das Privateigentum abzuschaffen. Das Gesetz des Privateigentums bestimmte seit dem Neolithikum die Organisation von Gesellschaften. Das wurde von der Revolution im Sinne der Ideen von Karl Marx außer Kraft gesetzt.
Revolution und Bürgerkrieg haben Millionen Menschen das Leben gekostet. Hat das Ihre Meinung beeinflusst?
Badiou: Auch die Politik des Privateigentums verzeichnet Millionen von Opfern. Der Erste Weltkrieg hat mehr Menschenleben gekostet als der Stalinismus. Letztendlich ist die Revolution zwar gescheitert, aber es war zumindest der praktische Versuch eines ideologischen Bruchs und der Beginn von etwas Neuem.
Es gibt Historiker, die die Oktoberrevolution gar nicht als Revolution, sondern als Staatsstreich bezeichnen. Was sagen Sie dazu?
Badiou: Das sind Bezeichnungen, die gerne von den Feinden der Revolution verwendet werden. Die Bilder der Revolution zeigen riesige Versammlungen, man sieht die Arbeiterräte, die sogenannten Sowjets, und Millionen Menschen. Warum sprechen Sie also von einem Staatsstreich? Außerdem stellt sich die Frage, was eine Revolution anderes sein soll als ein Staatsstreich: die Abschaffung eines Staates zugunsten eines neuen.
Man weiß inzwischen, dass die Bilder der Revolution manipuliert waren.
Badiou: Halten Sie die Französische Revolution auch für einen Staatsstreich? Lenin, der zu den Massen spricht, war Wirklichkeit. Ich sage Ihnen eines: Die Oktoberrevolution war weniger ein Staatsstreich als die Revolution von 1789, nämlich der Aufstand von Millionen Bauern und Arbeitern.
Sind Sie immer noch für die Abschaffung des Privateigentums?
Badiou: Mehr denn je. Wir haben keine Vorstellung davon, wie wir die Welt verändern könnten ohne die vollständige Zerstörung der kapitalistischen Form von Eigentum. Privateigentum bedeutet nichts anderes als das Ungeheuer der Ungleichheit. Die Welt, in der wir leben, ist eine krankhafte Welt. Die Kluft zwischen der kleinen Gruppe der globalen Oligarchie und den unteren Schichten der Gesellschaft ist heute größer als die Kluft zwischen den Adeligen und den Leibeigenen im Ancien Régime.
Gibt es heute noch Politiker, die diese
Idee vertreten?
Badiou: Ich gebe zu, dass die russische Revolution gescheitert ist, und auch die chinesische Revolution war nicht erfolgreich. Daher müssen wir einen neuen Anfang machen, und der Anfang dieses Anfangs ist es, von dessen Notwendigkeit überzeugt zu sein. Wir dürfen die blinde Gewalt des zeitgenössischen Kapitalismus nicht akzeptieren. Wir müssen die Welt, wie sie ist, ablehnen.
In welchem Sinne ist die Oktoberrevolution gescheitert?
Badiou: Am Anfang hat Lenin gesagt, alle Macht gehe von den Sowjets, den Arbeiterräten, aus. Das wäre eine gänzlich neue Form von Staatlichkeit gewesen, in der nicht eine kleine Gruppe die Massen regiert, sondern die Massen sich selbst. Das war in meinen Augen die wahre Bedeutung der Revolution. Dann gab es den Bürgerkrieg und die Notwendigkeit, zu einer militärischen Organisation zurückzukehren. Später kam dann Stalin, der gesagt hat, dass die Revolution vorüber sei. Damit hat er die Hoffnung zunichtegemacht, man könnte eine Gesellschaft gründen ohne einen von ihr losgelösten Staat. Offiziell gab es zwar kein Privateigentum, aber politisch gesehen war die Sowjetunion natürlich ein staatliches Gebilde. Die Kollektivierung der Produktionsmittel lief letztlich auf ein absolutes staatliches Eigentumsmonopol hinaus.
Und in China?
Badiou: In China war die Situation anders, hier spielte sich der Konflikt im kommunistischen Staat selbst ab. Mao hatte einen großen Teil der Kommunistischen Partei gegen sich. Wenn er von der Bourgeoisie in China gesprochen hat, haben ihn seine Gegner gefragt: Wo siehst du denn eine Bourgeoisie? Da hat er gesagt: Die sitzt mitten unter uns. Auch er hat das zentrale Problem nicht gelöst, nämlich die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Massen und dem Staat. Es bedürfte einer dritten Position, die diese Machtdichotomie auflöst, einer Vermittlungsinstanz, die möglicherweise in der Tradition der Sowjets oder der Komitees der chinesischen Kulturrevolution steht. Das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen.
Waren Sie während der Kulturrevolution in China?
Badiou: Nein, mir ist es wichtiger erschienen, hier vor Ort etwas zu tun. Wir haben die Texte gelesen und uns bemüht, das Verhältnis zwischen den Studierenden und den werktätigen Massen auf eine neue Basis zu stellen. Dabei haben wir neue Formen der Politik erprobt. Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre ist das immer schwieriger geworden, weil die neoliberale Gegenströmung immer stärker wurde. Mit diesem Zustand leben wir seit 40 Jahren.
Wie hat Ihre politische Arbeit konkret ausgesehen?
Badiou: Wir sind von einer kleinen Gruppe von Studenten ausgegangen. Dann haben wir eine Verbindung zu den Menschen in den Fabriken aufgebaut. Das war nur innerhalb eines entwickelten ideologischen Kontextes möglich. Mao hat gesagt, dass es unmöglich sei, eine neue Politik ohne ideologische Schulung zu machen. Daher muss auch heute der Kampf auf der ideologischen Ebene beginnen.
Hatten Sie denn auch Spaß bei dieser politischen Arbeit?
Badiou: Unter günstigen ideologischen Vorzeichen wird vieles probiert. In der Epoche von Karl Marx etwa, der Revolution von 1848, gab es den Anarchismus eines Bakunin oder den utopischen Kommunismus von Saint-Simon. So war es auch in den 70er-Jahren: Die eine Richtung ging eher in Richtung Disziplin und Militanz. Dann gab es aber auch die Kommunen, Musik und sexuelle Revolution in der Tradition des Frühsozialismus. Der ideologische Kontext ist immer viel größer als die Politik selbst.
Haben Sie jemals Gewalt angewandt?
Badiou: Es ist wohl unmöglich, das Privateigentum nur auf der Basis von Verhandlungen abzuschaffen. Der Gegner ist brutal, und er wird die Zerstörung mit allen Mitteln verhindern. Daher geht es nicht ohne Gewalt, die aber nicht am Anfang stehen sollte. Zuerst ist etwas Konstruktives wichtig: Überzeugung, Organisation und lokales Experimentieren. Gewalt sollte nur defensiv, als Schutz eingesetzt werden. Die Zapatisten in Mexiko etwa haben gesagt: Wir haben Waffen, aber wir setzen sie erst ein, wenn uns jemand angreift.
Was hat Sie an kommunistischen Führern wie Mao fasziniert?
Badiou: In der Geschichte der Revolutionen gab es immer große Namen, von Spartacus über Robespierre und Saint-Just bis Mao. Warum? Weil es jemanden braucht, der die Marschrichtung vorgibt. Es geht also nicht um die Faszination, sondern um die Repräsentanz der Massen, um ein Symbol für die Einheit des revolutionären Prozesses. Man hat die rote Flagge, den Namen dieser spezifischen Revolution und vielleicht auch noch eine Hymne, etwa die Internationale oder die Marseillaise. (Nun schaltet sich Cécile Winter ins Gespräch ein und ergänzt ihren Lebensgefährten.)
Cécile Winter: Führer wie Mao und Lenin waren nicht nur Symbole, sondern sehr real. Es gibt nur selten solche Ausnahmeerscheinungen. Ohne Lenin hätte es keine Oktoberrevolution und ohne Mao keine Kulturrevolution gegeben. Auch ein Mozart kommt nur einmal vor.
Badiou: Da gebe ich Cécile recht. Wir müssen Politik sehen wie ein Kunstwerk oder eine wissenschaftliche Erfindung. Robespierre, Lenin und Mao sind für die Revolution das, was Mozart und Beethoven für die Kunst und Newton und Einstein für die Wissenschaft waren.
Vor 100 Jahren gab es einen einfachen Feind, den ausbeuterischen Kapitalisten. Ist der Gegner heute nicht etwas sehr Abstraktes?
Winter: Sie müssen nur einmal eine Streikversammlung organisieren und eine Forderung stellen, und schon wissen Sie, wer der Boss ist. Nach Ihrer ersten Aktion kennen Sie den Feind.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:
Der einsame Kämpfer
Wolfgang Zwander in FALTER 49/2014 vom 03.12.2014 (S. 18)
Heute herrscht weitgehend die Meinung vor, der Kommunismus sei ein Phänomen vergangener Dekaden (siehe große Rezension). Einer, der das anders sieht, ist der französische Philosoph Alain Badiou.
Er ist Europas prominenteste Stimme für eine Renaissance des Kommunismus. In einem Gesprächsband, der im kleinen Wiener Passagen Verlag erschienen ist, erläutert Badiou die philosophischen Gründe für seine politische Überzeugung – und warum er an dieser trotz negativer historischer Erfahrungen festhält.
Die Lektüre loht sich für alle, die ihr Denken anregen wollen. Man muss Badiou nicht immer folgen, um sich von seinen Gedankengängen inspirieren zu lassen.