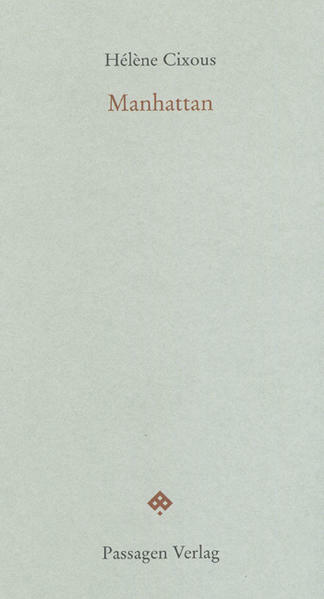„Ich habe viele Anfänge“
Matthias Dusini in FALTER 33/2017 vom 16.08.2017 (S. 28)
Die französische Schriftstellerin Hélène Cixous wollte Journalistin und Schauspielerin werden. Dann kam die Nacht, die alles veränderte. Ein Gespräch über Traum und Trauma
Die 80-jährige Hélène Cixous ist eine Ikone der Postmoderne, sie verfasste feministische Schlüsseltexte. Cixous erhob das „weibliche Schreiben“ zum politischen Akt. In dem 1975 erschienenen Manifest „Das Lachen der Medusa“ attackierte sie das männliche Vernunftregime und forderte die Frauen dazu auf, ihre sexuellen Wünsche auszuleben. Cixous schreibt in einem bewusst kryptischen Stil, der keinen Unterschied zwischen Wissenschaft und Literatur macht.
Nach 1968 war sie mit Michel Foucault und Gilles Deleuze an der Gründung der Reformuniversität Vincennes beteiligt. Aus einer von den Nazis verfolgten jüdischen Familie stammend, entwickelte Cixous eine Liebe zur deutschen Sprache. Der Wiener Passagen Verlag machte es sich zur Aufgabe, das hierzulande eher unbekannte Werk Cixous’ zu übersetzen. Das Gespräch fand Ende Mai statt, als die Autorin zu einer Lesung in Wien weilte. Leider kann das helle Lachen nicht wiedergegeben werden, das ihre Aussagen fast durchwegs begleitete.
Falter: Frau Cixous, womit hat Ihre Karriere als Autorin begonnen?
Hélène Cixous: Wie viel Zeit haben wir?
Das hängt von Ihnen ab.
Cixous: Ich frage deshalb, weil ich einige Zeit brauche, um auf diese Frage zu antworten. Als ich zehn Jahre alt war, wollte ich Journalistin werden, ohne zu wissen, was das überhaupt ist. Ich habe damals mit meiner Familie in Algerien gelebt. Mit einem Bus bin ich zur größten Zeitungsredaktion von Algier gefahren und habe gefragt, ob ich mit dem Chef sprechen kann. An der Rezeption hat man mich gefragt, was ich will, und mir ein Formular zum Ausfüllen gegeben. Ich sollte warten, die Tür ging zu und nach zwei Minuten hörte ich ein schallendes Gelächter. Das war hart. Ich bin rausgegangen, und das war’s dann mit meiner Karriere als Journalistin.
Wie würden Sie Ihr Verhalten im Nachhinein interpretieren?
Cixous: Dass ich viel wollte, aber an der Realität scheiterte. Im nächsten Jahr wollte ich Schauspielerin werden, sah mich in tragischen Rollen. Wieder bin ich losgezogen und ins Konservatorium gegangen. Die nächsten sechs Monate habe ich Kurse besucht, und am Ende wollte ich eine Rolle übernehmen, Phaidra von Jean Racine. Der Lehrer hat gesagt: Du bist ja erst zwölf, ich lass dich sicher nicht die Phaidra spielen, lies erst einmal eine Fabel von La Fontaine. Meine Karriere als Tragödin war damit ebenfalls beendet. Gott sei Dank!
Wann haben Sie denn nun wirklich zu schreiben begonnen?
Cixous: Ich wollte immer mit Sprache arbeiten und habe nie daran gezweifelt, dass ich das kann. Ich habe nur nicht gewusst, wie ich es anstellen soll. Mit 17 habe ich Jean-Jacques Rousseaus „Bekenntnisse“ gelesen und hatte dabei eine Art Erleuchtung. Das Buch ist ein Meisterwerk, einfach perfekt. Aber nachdem ich während der Lektüre einige Seite geschrieben hatte, wurde mir bewusst: Ich bin nicht Rousseau, Schreiben hat nichts mit Imitieren zu tun.
Wann ging es dann los?
Cixous: Das Schreiben ist auf mich zugekommen wie ein Tornado, in nächtlichen Visionen. Ich habe nicht nach den Texten gesucht, sondern sie sind mir passiert. Zuerst dachte ich, ich schnappe über.
Was hat Sie davon überzeugt, dass dem nicht so ist?
Cixous: Ich bin zu Derrida gegangen, den ich 1963 eher zufällig in einem Café kennengelernt hatte. Ich habe zu ihm gesagt: Bitte schau dir das einmal an. Ich habe Angst, von Dämonen besessen zu sein, und sollte wohl zu einem Psychiater gehen. Er hat nur gesagt: Ein Meisterwerk! Der Text wurde sofort veröffentlicht und Derrida hat eine längere Abhandlung darüber verfasst, wie meine Zeilen auf ihn gewirkt haben.
Für Autoren ist es ein tolles Gefühl, wenn sie sich zum ersten Mal gedruckt sehen. Wie war das bei Ihnen?
Cixous: Anders. Ich wusste ja, dass der Text nicht von mir ist. Ich habe mich nicht als Autorin, sondern als Medium gesehen, das Dinge empfängt. Daher war ich ja so verängstigt. Es war, als würde ich eine Klippe entlangtaumeln.
Sie sind in einer mehrsprachigen Umgebung aufgewachsen. Ich welcher Sprache haben geschrieben?
Cixous: Meine Eltern haben französisch gesprochen, meine Großmutter sprach mit deutschem Akzent. Mein Vater fand die deutsche Sprache lustig und hat die Wörter meiner Großmutter imitiert, sodass auch ein lustiges Kinderdeutsch gesprochen wurde. Meine Großmutter väterlicherseits hatte Spanisch als Muttersprache. Es machte Spaß, von einem Klang zum anderen zu springen. Und auch wenn ich immer auf Französisch geschrieben habe, war es immer anglisiert, verdeutscht und spanifiziert.
Haben Sie als Kind gerne gelesen?
Cixous: Bücher waren schon damals mein Leben. Ich habe fast die gesamte französische Literatur gelesen, dann auch die gesamte englisch- und deutschsprachige Literatur. Mit 22 habe ich meine Dissertation über James Joyce geschrieben, als jüngste Dissertantin in Frankreich überhaupt, was ein Glücksfall war. Durch Joyce habe ich die klassischen Erzählformen hinter mir gelassen und war mitten drin in der Moderne. Seither weiß ich, dass man beim Schreiben frei sein und alle Formen selbst erfinden kann.
Ist das Schreiben ein Bekennen – wie Rousseau in seinen „Confessions“?
Cixous: Natürlich nicht, ich beichte nicht, sondern rezipiere. Bis vor 15 Jahren habe ich mich nicht als Schriftstellerin bezeichnet. Auf die Frage, was ich von Beruf sei, habe ich geantwortet: Ich schreibe. Ich erzähle auch keine Geschichten im traditionellen Sinne, sondern verfasse Fragmente, die aus einer Geschichte stammen könnten, aber keine sind, ohne Anfang und Ende.
Aber Ihr Leben hat doch auch einen Anfang.
Cixous: Mein Leben hat mehrere Anfänge und ich habe auch nicht ein, sondern mehrere Leben. Das Leben meiner Mutter etwa ist in mir. Wenn sie mir ihre Geschichte erzählt hat, war das für mich wie ein wunderbarer Film. Diese Erinnerungen wurden ein Teil von mir, auch wenn ich sie nicht selbst erlebt habe. Dasselbe mit meiner deutschen Großmutter. Ich erinnere mich an ein Ereignis, das sie mit fünf Jahren erlebt hatte. Sie musste 1887 vor dem Kaiser ein Gedicht von Heinrich Heine vortragen. Das war für mich so lebendig, dass ich mir dachte, ich bin in den 1880er-Jahren geboren.
Sind diese Erlebnisse nicht auch Geschichten?
Cixous: Eher Umstände, die recht ähnlich sind: Kriege und Katastrophen. Positive Ereignisse, die ins Gegenteil kippen. So hat meine Großmutter in jungen Jahren geheiratet. Mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, stammte aus dem slowakischen Teil des K.-u.-k.-Reichs und hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war er davon überzeugt, er müsste die Ehre des Vaterlands verteidigen. Bereits nach wenigen Wochen ist er gefallen. Sein Eisernes Kreuz bewahre ich immer noch auf. Keine 20 Jahre später kamen die Nazis und meine jüdische Familie wurde zerstört. Viele Verwandte wurden deportiert und ermordet. Mein Bild vom Leben ist also geprägt von Harmonie und Glück auf der einen Seite und von Gewalt, Tod und Ausgrenzung auf der anderen Seite.
Ist Ihr Schreiben eine Rückkehr zum Ursprung, wie das in der Psychoanalyse der Fall ist?
Cixous: Nein, es ist Gegenwart und nicht sentimental. Ich bin keine Historikerin, sondern eine Dichterin. Mich interessiert die Vergangenheit einfach, etwa, wie meine Großmutter noch rauskam nach der sogenannten Reichskristallnacht im November 1938. Ich weiß, dass es Sigmund Freud beinahe nicht geschafft hätte. Solche Details faszinieren mich.
Wie kam Ihre Großmutter aus Deutschland raus?
Cixous: Der französische Konsul in Dresden hat meine Großmutter darüber informiert, dass sie die französische Staatsbürgerschaft hat, von der sie nichts wusste. Das kam daher, dass mein deutscher Großvater aus dem Elsass stammte. Nach dem Ersten Weltkrieg kam das Elsass zu Frankreich und die Bewohner hatten Anrecht auf zwei Pässe.
In der Psychotherapie gibt es den Begriff des Traumas. Man kehrt zurück zu einem schrecklichen Ereignis, um es zu überwinden. Machen Sie das auch?
Cixous: Nein. Zum Glück waren meine „Mütter“ nicht traumatisiert. Sie waren einfache, starke Frauen, die das Leben geliebt haben.
Der Ursprung des Sinns war ein großes Thema der Postmoderne. Ihr Freund Derrida etwa kritisierte diesen Begriff, weil er die Heimat und Identität verklärt. Sehen Sie das auch so?
Cixous: Wir waren da einer Meinung, aber für mich war diese Überzeugung keine ausgearbeitete Philosophie, sondern die Art, wie ich dachte. Es war einfach selbstverständlich, dass es mehrere Anfänge gibt und dass alles immer wieder von neuem beginnt. Als ich Derrida traf, habe ich sofort gemerkt, dass er meine Sprache spricht.
Was sagte Ihre Mutter zum Erstling?
Cixous: Sie war nicht in Frankreich, sondern arbeitete als Hebamme in der Kasbah von Algier. Sie hat es gar nicht mitbekommen, dass das Buch rauskam. Ich habe es ihr auch gar nicht gesagt, weil ich Angst vor ihrer Reaktion hatte. Wahrscheinlich hätte sie gesagt: Schreiben ist doch kein Beruf! Sie hatte ein hartes Leben, und daher kam das für sie nicht infrage. Erst als ich 1969 für „Dedans“ den Prix Médicis bekommen habe, hat sie das in der Zeitung gelesen. Sie schrieb mir einen Brief, in dem stand: Was hast du sonst noch für Dummheiten gemacht?
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: