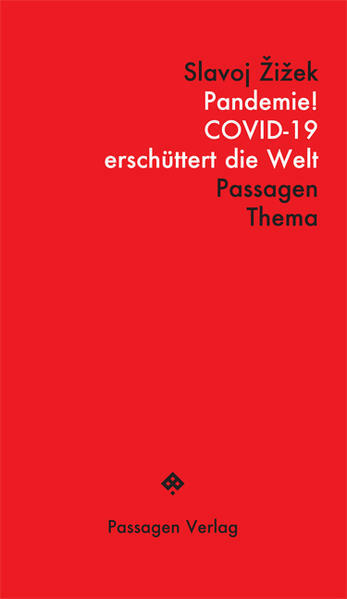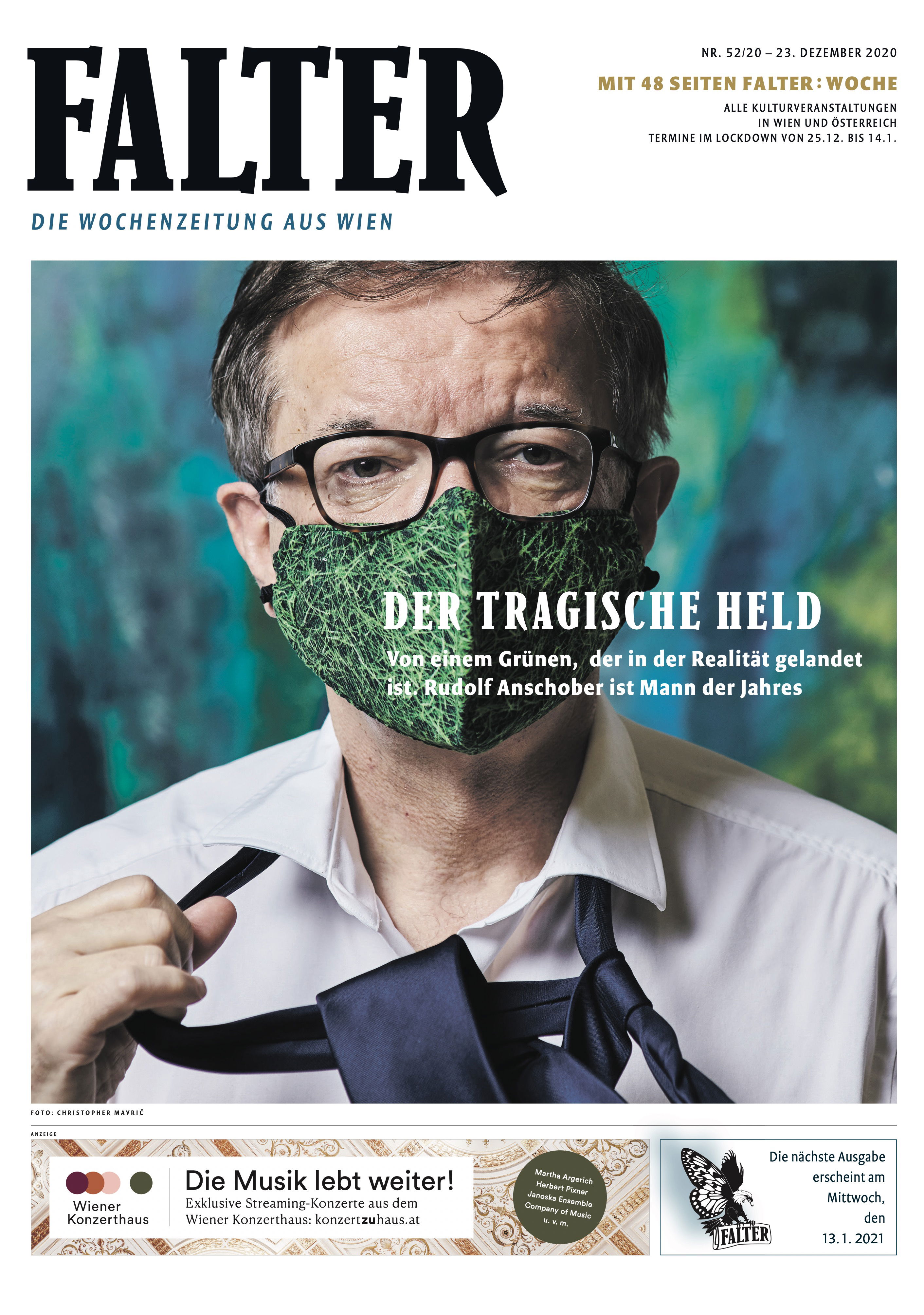
Im Kriegskommunismus
Robert Misik in FALTER 52-53/2020 vom 23.12.2020 (S. 26)
Es gibt diese Bücher, die man mit vorsichtigen Erwartungen in die Hand nimmt. Nach beinahe 30 Jahren, in denen jedes Jahr ein Buch von Slavoj Žižek erscheint, in denen mit gewissen Variationen mehr oder weniger die gleichen Gedanken und Anekdoten rekombiniert werden, ist man als Leser zumindest darauf vorbereitet, sich langweilen zu lassen. Hinzu kommt: Es gibt ja diesen öden Voluntarismus, der immer, wenn irgendetwas geschieht, die Krise "zur Chance" erklärt.
Es gibt diese Bücher, die man mit vorsichtigen Erwartungen in die Hand nimmt. Nach beinahe 30 Jahren, in denen jedes Jahr ein Buch von Slavoj Žižek erscheint, in denen mit gewissen Variationen mehr oder weniger die gleichen Gedanken und Anekdoten rekombiniert werden, ist man als Leser zumindest darauf vorbereitet, sich langweilen zu lassen. Hinzu kommt: Es gibt ja diesen öden Voluntarismus, der immer, wenn irgendetwas geschieht, die Krise "zur Chance" erklärt.
Slavoj Žižek ist so etwas wie ein pessimistischer Optimist. Ein wenig gehört er immer zur "Krise als Chance"-Schule. Gewisse voluntaristische Proklamationen und großspurige Behauptungen gehören zum Gestus jener Radikalität, die zu seinem Markenzeichen geworden ist, so wie auch jetzt die Idee, dass auf die Krise eine neue Form des Kommunismus folgen würde.
Aber wenn man das einmal beiseite lässt, sind Žižeks Überlegungen recht pragmatisch und vernünftiger als vieles andere, was man heute so an aufgewühlten Zeitdiagnosen der pandemischen Gesellschaft zu lesen bekommt.
Die Epidemie kann zurückgedrängt werden, sagt Žižek, den Chef der WHO zitierend, aber nur durch "einen kollektiven, koordinierten und großangelegten Ansatz, der die gesamte Staatsmaschinerie in Bewegung versetzt". Bei allem Schock und bei aller Katastrophe hatte das, wie entschlossen Regierungen im Frühjahr gehandelt haben, auch ein gewisses Pathos des Handelns, eine Tat-Ästhetik.
Dass im "Katastrophen-Kapitalismus" der Mensch nichts zählt, der Markt das Individuum zermalmt, die Solidarität zerreißt, ein immer autoritärerer Maßnahmenstaat etabliert wird - all das sieht Žižek nicht so. Regierungen opfern sogar kapitalistische Profite dafür, so viele Menschenleben wie möglich zu retten.
Gewiss, sieht man genauer hin, ist nicht jedes Leben gleich viel wert, und manche mäkeln auch genau daran herum, nämlich dass man bereit sei, "alles zu opfern, um der Gefahr einer Erkrankung zu entgehen - die normalen Lebensbedingungen, die sozialen Beziehungen, sogar die Freundschaften, Zuneigungen und religiösen und politischen Überzeugungen".
Aber anders als manche zeitgenössischen Radical-Chic-Autoren sieht Žižek nicht nur die Menschen in Todesangst isoliert. "Die Todesgefahr verbindet die Menschen auch miteinander." Es gäbe sogar eine neue Form von Solidarität. "Einander nicht die Hände zu schütteln und sich zu isolieren, wenn es nötig ist, ist die heutige Form von Solidarität."
Pandemien können Gesellschaften zerreißen, die Weltgesellschaft in Egoismen zerfallen lassen. Dies ist aber nicht geschehen. Versuche von Nationen, sich etwa den Impfstoff exklusiv zu sichern, sind zurückgeschlagen worden. Der Impfstoff werde für die gesamte Welt produziert -es werde dabei sicher noch ungerecht genug zugehen, aber ein planetarisches Ethos wurde verteidigt. Der Staat nahm die Notproduktion in die Hand. Niemand, der bei Trost ist, würde auf irgendeinen "Markt" vertrauen, es regiert eine Art von Kriegswirtschaft. Um sich isolieren und überleben zu können, muss gewährleistet sein, "dass grundlegende öffentliche Dienstleistungen weiter angeboten werden: Elektrizität und Wasser, Essen und Medizin müssen weiter verfügbar sein". Um die Alten und Schwachen schützen und versorgen zu können, braucht es ein ordentliches staatliches Gesundheitssystem, aber auch das lokale Engagement in Communitys. Žižek: "Erst aus dieser tödlichen Bedrohung erwächst die Vorstellung einer vereinten Menschheit."
Menschen machen ihre Arbeit, unterrichten ihre Kinder, nehmen zwischendurch an Videokonferenzen teil, gehen vielleicht sogar für die Nachbarin einkaufen und versuchen einfach, weiter zu funktionieren. "Mehr denn je", zitiert Žižek aus einem Zeitungskommentar, "geht es um die Vorstellung von einer Welt, in der sie eine Wohnung haben, Grundnahrungsmittel und Wasser, die Liebe anderer Menschen und eine Aufgabe, die wirklich etwas bedeutet". Damit, so Žižek, werde doch "ein anständiges und nicht-entfremdetes Leben" schon ganz gut beschrieben.
Das ist es, was Žižek unseren Kommunismus nennt. "Unglücklicherweise ist das eine Variante dessen, was 1918 in der Sowjetunion 'Kriegskommunismus' genannt wurde." Womöglich liegt Žižek damit ja richtig und falsch zugleich. Wer die Geschichte des Kommunismus kennt, weiß, dass die Analogie eine verkehrte ist: Die Bolschewiki kopierten, mangels eines besseren Sozialismus-Modells, das Wirtschaftssystem der deutschen "Kriegswirtschaft", in der alles zentral gesteuert war und Trusts und Konzerne von der Regierung in eine gemeinsame Anstrengung eingespannt wurden.
Damals zum Zweck des Todes, diesmal zum Zweck des Lebens.