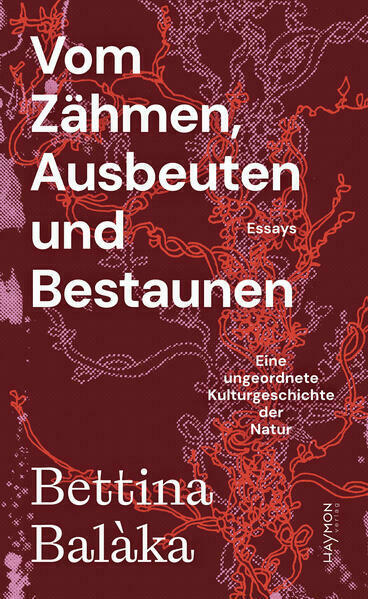Käpt’n Krebsi, ahoi!
Julia Kospach in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 39)
Wie es kommt, dass das Fußballfeld zur Maßeinheit für Bodenversiegelung und Rodung wurde? Weil man sich so die Flächenausmaße besser vorstellen kann. Und doch bleibt es unvorstellbar, ganz gleich, wie oft man die Zahlen schon gehört hat: Pro Tag wird in Österreich eine Fläche von 18 Fußballfeldern versiegelt, im amazonischen Regenwald pro Tag eine Fläche von 4340 Fußballfeldern abgeholzt.
Wir fahren Schlitten mit der Natur, ihren Ressourcen und Geschöpfen und verhalten uns dabei so widersprüchlich, wie es nur die Spezies Mensch zusammenbringt: „Das Bedürfnis, Ordnung durch Bodenversiegelung herzustellen, geht einher mit dem komplementären Bedürfnis, der Asphaltwüste der Städte zu entfliehen und in möglichst unberührten Wäldern Lebensenergie aufzutanken“, schreibt Bettina Balàka in ihrem neuen Essayband mit dem grenzgenialen Titel „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“. Dabei handelt es sich, so der Untertitel, um „eine ungeordnete Kulturgeschichte der Natur“, vor allem aber um eine Bestandsaufnahme des ambivalenten Verhältnisses des Menschen zu dieser Natur.
Bettina Balàka ist eine Autorin mit ausgeprägten Interessen, die sich in den Themen und Motiven ihrer Romane und Essays niederschlagen: Naturwissenschaften und Geschichtsschreibung aus feministischer Sicht gehören dazu, ebenso Tier-Mensch-Beziehungen oder die Biografien von Forscher:innen. Ihre neuen Essays passen bestens in dieses Spektrum. Sie sind weniger Anklage als das Aufzeigen der abstrusen Willkürherrschaft, die die Menschheit sich über die Natur anmaßt, eine Herrschaft, die in der von Balàka aufgezeigten Dichtheit deutlich macht, wie blind-gemütlich wir uns in Widersprüchen eingerichtet haben, die uns eigentlich zerreißen müssten: etwa dass wir „ebenso strikt wie willkürlich“ zwischen Haus- und Nutztieren unterscheiden und daraus Regeln für den Umgang mit diesen ableiten. Dass wir eine „verrückte, comicartige Welt“ geschaffen haben, in der Abermillionen „Kühe mit riesigen Eutern“ oder „Puten mit überdimensionierten Brustmuskeln“ leiden, oder dass wir Zootiere mit Psychopharmaka ruhigstellen, um die Illusion von artgerechter Haltung aufrechtzuerhalten.
Sehr eindrucksvoll zeigt Balàka auch auf, wie allgegenwärtig eine Rhetorik ist, die Tierschützer:innen als sentimental und unvernünftig verspottet – „als ob ausgerechnet Tierquälerei ein Zeichen von höherer Intelligenz, ethischer Überlegenheit und zivilisatorischem Fortschritt wäre“. Nicht minder eindrucksvoll sind umgekehrt ihre Erzählungen von Menschen, die sich von ihrer Einsicht in Tierleid und Naturzerstörung nachhaltig verändern ließen und gleichsam die Seiten wechselten: etwa der Schriftsteller Ignaz Franz Castelli (1781–1862), der von einem tierquälerischen Jungen zum Gründer des Wiener Tierschutzvereins wurde, oder Ric O’Barry, Fänger und Tiertrainer der fünf für die TV-Serie „Flipper“ eingesetzten Delfine, der eine radikale Kehrtwendung hin zum Gegner der Haltung von Meeressäugern durchmachte.
Auch viel Interessantes zur Historie der Mensch-Natur-Beziehung sowie zu moderner Forschung ist aus Balàkas Buch zu erfahren. Das reicht von den Veränderungen in der Pferdehaltung, die der Erfolgsroman „Black Beauty“ (1877) bewirkte, über aktuelle Erkenntnisse der Verhaltensbiologie, welche immer genauer nachweisen kann, „wie sehr wir uns in unseren angenehm herablassenden Vorstellungen vom Tier als gefühllosem Automat geirrt haben“, bis hin zu sehr anrührenden Porträts einzelner Tierindividuen. Darunter „Käpt’n Krebsi“, ein Landeinsiedlerkrebs, der 15 Jahre lang Balàkas Haustier war und dem es, obwohl er nicht als höheres Tier gilt, trotzdem gelang, sich seiner Besitzerfamilie in seinen Bedürfnissen „verständlich zu machen“. „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“ ist ein sehr erhellendes Buch, wie gemacht, um Verhaltensänderungen anzustoßen.