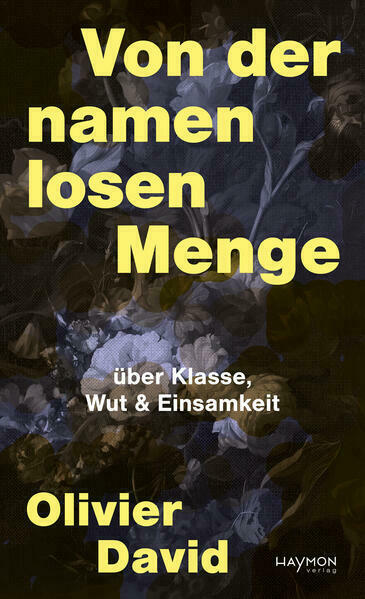Die Wut der unteren Klassen
Robert Misik in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 18)
Menschen aus der Arbeiterklasse haben an ihrem Körper "Arbeitsnarben","Klassennarben"; jene aus der Mittel-und Oberschicht eher "Freizeitnarben","Hobbynarben", etwa vom Sport. "Die Fälle, in denen körperliche Arbeit nicht gut ausgeht, sind es, die die Lebensläufe vieler Menschen in der unteren Klasse bestimmen", schreibt Olivier David in seinem Großessay "Von der namenlosen Menge", der die Lebenswelten und Verwundungen der arbeitenden Klassen und der Unterschichten seziert. Das frühe Sterben, die Abnutzung, die psychischen Bedrängungen, die mentalen Krankheiten, das Nur-eine-Nummer-Sein, eben: Namenlossein.
Olivier Davids Buch ist mehr als eine teilnehmende Beobachtung. David spricht von "meinen Leuten". Selbst ist er in Hamburg in den sogenannten "schlechten Vierteln" aufgewachsen. Straßenkind. Seine Eltern arm, gestrandet. Drogen sind im Spiel, regelmäßige Gefängnisaufenthalte des Vaters. Schon die Großeltern immer in diesem Milieu. Es sind seine Realitäten, und er kennt die Mentalitäten. "Ein Ertrinkender denkt in aller Regel nicht wohlwollend oder voller Schmerz an andere Ertrinkende, dafür ist er zu sehr mit seinem eigenen Ertrinken beschäftigt." Die Ressourcen an Solidarität sind endlich.
David kennt aber auch die anderen Welten: Seine Mutter gibt ihn in eine Waldorf-Schule, die er irgendwann schmeißt. Je nach Milieu ist er ein anderer.
Davids zorniges Buch reiht sich in das autofiktionale Schreiben ein, das heute mit Namen wie Annie Ernaux, Didier Eribon oder Edouard Louis verbunden ist, eine Textgattung, die manchmal auch als Arbeiterklassenliteratur beschrieben wird, aber oft eigentlich eine "Wie ich die Arbeiterklasse verlassen habe"-Literatur ist.
Bei David ist das alles härter, noch näher dran, damit auch ohne Sentimentalitäten und weniger Ich-Umkreisung. Über sich selbst sagt er ganz ungeschützt: "Ich trage eine Wut in mir." Die ist bei ihm mit einer guten Portion an Selbstreflexion verbunden.