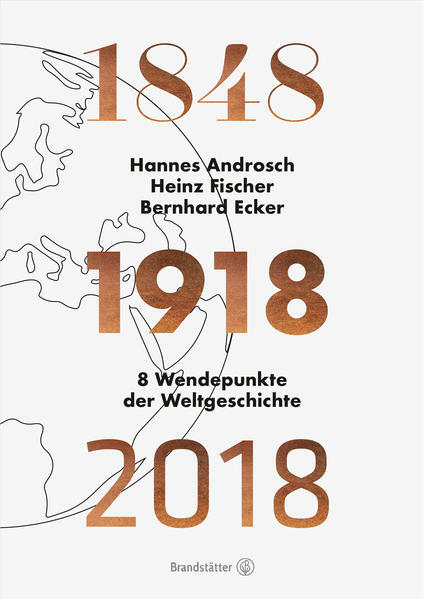Nicht nur 1848, 1918 & 1968, sondern auch 1978 & 2008
Barbaba Tóth in FALTER 1-2/2018 vom 10.01.2018 (S. 19)
Ein Jubiläumsjahr-Sammelband sucht sich andere als die logischen Achterjahre aus und erzählt so ein Stückchen Weltgeschichte neu
Die Jubiläumsjahrbewirtschaftung ist ein einträgliches und gleichzeitig ein leidiges Geschäft für Autorinnen und Historiker. Sie garantiert Auflage und Aufmerksamkeit, gleichzeitig unterwirft sich damit auch die Erinnerungskultur immer mehr einem meist nationalen Mainstream, der von großen Verlagen und Medienanstalten gesteuert wird. Alternative Blicke zurück, supranationale Aspekte, überhaupt andere historische Themen haben es in Jubiläumsjahren, wie es 2018 ist, viel schwerer durchzudringen.
Das Achterjahr bietet besonders viele Anknüpfungspunkte. Aus deutscher Sicht ist der Dreißigjährige Krieg ein großes Thema (1618–1648), aus österreichischer sind es die Jahre 1918 und 1938. In der Tschechischen Republik wird 1968 eine größere Rolle spielen als in Ungarn (siehe Rezension in der Spalte rechts). Die Herausgeber Hannes Androsch, Heinz Fischer (beide Jahrgang 1938) und Bernhard Ecker haben sich in ihrem Sammelband „1848, 1918, 2018“ für einen interessanten Kompromiss entschieden. Die beiden Ex-Politiker und der Trend-Autor greifen insgesamt acht Wendepunkte der Weltgeschichte heraus, um zurück und nach vorn zu blicken.
Darunter sind die üblichen Verdächtigen wie der „Epochenwechsel 1848“, zusammengefasst vom Journalisten Hans-Werner Scheidl, das Gründungsjahr der Ersten Republik, beschrieben vom Politologen Anton Pelinka, und das Hippie-Jahr 1968, vom Journalisten und Zeitzeugen Herbert Lackner als „unterschätztes Wendejahr“ porträtiert. Im Sammelband wird aber auch der bosnischen Annexionskrise des Jahres 1908 und ihrer „Geschichtsmacht“ auf den Westbalkan gedacht, beschrieben von der Politologin Bettina Poller. Mitherausgeber Bernhard Ecker erinnert an Chinas Aufbruch in den Westen im Jahr 1978, die Ökonomin Helene Schuberth an den Zusammenbruch der Lehman Brothers im Jahr 2008 und die Journalistin Alexandra Föderl-Schmid an den Big Bang durch Big Data in der Gegenwart, also im Jahr 2018.
Ein ungewöhnlicher Blick auf 1938
Etwas gewöhnungsbedürftig ist der Zugang, den der Mathematiker Rudolf Taschner, mittlerweile ÖVP-Nationalratsabgeordneter, zum Jahr 1938 wählt. Er beschreibt nicht den „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland, die Vertreibung der jüdischen Intelligenz und die Folgen, die dieser „Braindrain“ bis heute für Österreichs Wissenschaftslandschaft hat. Sondern er stellt zwei bahnbrechende Erfindungen vor, die im gleichen Jahr in Berlin getätigt wurden. Konrad Zuse erfindet einen mechanischen Vorläufer späterer Computer, Otto Hahn und Fritz Straßmann entdecken den Zerfall von Uran durch Neutronenbeschuss.
Ohne die Analyse der Physikerin Lise Meitner wäre die Entdeckung unvollkommen geblieben. Die Jüdin Meitner hatte Hitler-Deutschland im Sommer 1938 verlassen müssen und publizierte die erste kernphysikalische Deutung der Hahn-Straßmann’schen Ergebnisse gemeinsam mit ihrem Neffen Otto Frisch dann Anfang 1939 aus dem schwedischen Exil in der englischen Zeitschrift Nature.
Die Lehren aus 2008
Schlüssiger liest sich da schon der Beitrag Helene Schuberths. Die Ökonomin stellt in ihrem Beitrag zur Finanzmarktkrise 2008 die spannende Frage: Wiederholt sich die Geschichte doch? Die internationale Staatengemeinschaft beteuerte 2008, die Fehler der 1930er-Jahre nicht wiederholen zu wollen. Aber es gelang ihr nicht.
Schuberth arbeitet die wesentlichen Parallelen zur Weltwirtschaftskrise heraus. Wie in den 1920er-Jahren war der Krise eine Phase vorausgegangen, in der das Finanzsystem liberalisiert wurde. Es kam seit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse Anfang der 1970er-Jahre zu einem regelrechten Deregulierungswettbewerb. Es folgten „spekulative Exzesse unproduktiver Rentiers, steigende Ungleichheit der Einkommen und Vermögen“ sowie die „Hegemonie wirtschaftsliberaler Paradigmen, die staatlichen Eingriffen ablehnend gegenüberstehen“.
Auch in der Krisenbekämpfung ist das „historische Gedächtnis einer vorsätzlich herbeigeführten Amnesie zum Opfer gefallen“, formuliert Schuberth. Keine Spur von der angekündigten grundlegenden Reform des Weltfinanzsystems, auch wenn in Sachen Geldpolitik und Banken- und Finanzmarktstabilisierung vieles getan wurde.
Auch die Folgen des Jahres 2008 lassen sich aus Schuberths Sicht mit jenen der 1930er-Jahre durchaus vergleichen. Sie zeichnet ein düsteres Bild der nahen Zukunft. Auf dem Humus der wachsenden Ungleichheit gedeihen rechtsradikale Bewegungen, die ihre neoliberale Grundhaltung in den Krisenjahren um globalisierungskritische und national-soziale Positionen ergänzt haben. Die Gesellschaften in Europa sind nach dem „verlorenen Jahrzehnt“ 2008 bis 2018 polarisiert, soziale Konflikte wurden ethnisiert. Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit und autoritäre bis hin zu faschistischen politischen Bewegungen sind auf dem Vormarsch.
Mitherausgeber Hannes Androsch verwendet im Epilog zum Sammelband den vom Historiker Reinhart Koselleck geprägten Begriff „Sattelzeit“. Er beschreibt eine „Epochenschwelle“. So wie zwischen 1750 und 1850 das Agrar- vom Industriezeitalter abgelöst wurde, erleben wir heute den Übergang vom Industrie- ins digitale Zeitalter. Die tragende politische Mitte, Anker der Nachkriegsjahre, habe sich überlebt, Bewegungen der Extreme surften auf dem rechten Zeitgeist eben leichter.
Nur ein Thema fehlt in diesem Sammelband schmerzlich: Europa. Aber die Geschichte der Europäischen Union tickt nicht im Achterjahr-, sondern im Neunerjahr-Rhythmus. 2019 jährt sich der Fall des Eisernen Vorhangs zum 30. und der Vertrag von Lissabon zum zehnten Mal.