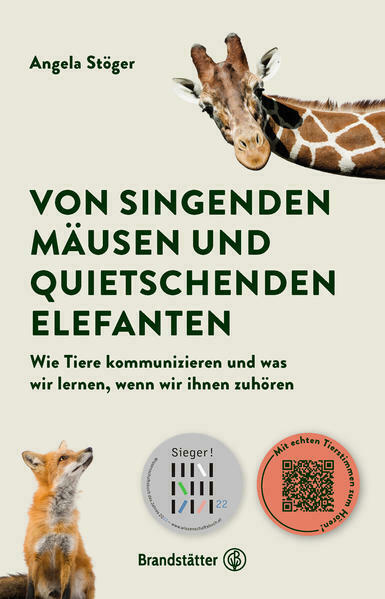Verstehen Sie Törö?
Patricia McAllister-Käfer in FALTER 35/2024 vom 28.08.2024 (S. 43)
Wissenschaftler nutzen Künstliche Intelligenz, um zu begreifen, wie Tiere miteinander kommunizieren. Die Elefantenforscherin Angela Stöger durchforstet dafür ihre Daten - und möchte ein "Elefanten-Siri" bauen
Es wäre ja nicht unlogisch, dass Elefanten einander beim Namen rufen können. Die Tiere leben - wie auch Papageien, Delfine oder Menschen -in sogenannten Fission-Fusion-Gemeinschaften. Also Gruppen, die sich spalten und wieder zusammenkommen, was im Elefantenalltag bedeutet: Sie teilen sich morgens zum Fressen in kleinere Gruppen auf, treffen dabei befreundete Elefanten anderer Verbände und kommen abends wieder in der Familie zusammen.
"Die Tiere wandern auseinander, bleiben jedoch ständig akustisch in Kontakt und koordinieren sich", erzählt Angela Stöger. Da wäre es natürlich höflich, den anderen bei der Heimkehr auch namentlich zu grüßen. Stöger ist Verhaltensforscherin mit dem - für eine Wienerin recht exotischen -Spezialgebiet der Elefanten und ihrer Kommunikation. Sie arbeitet am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und ist Leiterin der Tierhaltung am Biologieinstitut der Universität Wien.
Vor allem eine neue internationale Studie hat ihr Forschungsgebiet zuletzt in die Medien gebracht: "Elefanten nennen einander beim Namen", titelte etwa der britische Guardian und bezog sich auf eine Studie in der Fachzeitschrift Nature. Die Arbeit der US-amerikanischen Forschertruppe ließ Großes erahnen: Afrikanische Savannenelefanten geben Mitgliedern ihrer Herde Namen. Aber kann das überhaupt sein?
Anderen einen Namen zu geben ist eine bedeutende Sache. Entdecker einer neuen Tierart dürfen diese benennen, Schlagersänger setzen auf Künstlernamen, Eltern taufen ihre Kinder. In jedem Fall ist das Benennen "Menschensache" - wir haben schließlich als einzige Spezies eine Sprache, also ein Verständigungssystem derartiger Komplexität. Und Namen zu vergeben ist ein menschliches Alleinstellungsmerkmal.
So dachten wir zumindest lange. Doch dann kam vor etwa zehn Jahren heraus, dass auch Delfine, konkret Große Tümmler, für ihre Artgenossen bestimmte Namen verwenden, indem sie sie mit ihren charakteristischen Pfeiftönen rufen. Schnell schränkten Forschende ein, dass diese Namen "nur" eine Nachahmung der jeweiligen "Signaturpfiffe" der Tiere sind. Delfine entwickeln diese Tonfolgen als Ausdruck ihrer Individualität. Ihre Tümmler-Artgenossen rufen sie dann mit jenem Pfiff, den sie selbst besonders gern und häufig von sich geben.
Doch nur weil Delfine nicht wirklich Namen vergeben, müsste das noch lange nicht heißen, dass Elefanten das nicht können.
Angela Stöger erforscht seit über 20 Jahren Elefanten in Afrika, Asien und Europa. In ihrer Jugend war sie Synchronschwimmerin und wollte sich eigentlich auf Wale und andere Meeressäuger spezialisieren. Doch dann begleitete sie für ihre Diplomarbeit ab 2001 die akustische Entwicklung des damals neugeborenen Bullen Abu in Schönbrunn -mit dem Elefantenbaby war es um sie geschehen. Für ihre Dissertation untersuchte sie dann erstmals Elefanten in deren natürlichem Lebensraum in Kenia und Südafrika.
Vorweg: Elefanten trompeten jedenfalls nicht den Namen ihrer Artgenossen, wenn das auch der bekannteste Elefantenlaut ist. Sie "rumblen" ihn. Darunter ist ein tieffrequentes Grummeln zu verstehen, das die Tiere einander in den Ebenen der Savanne auch über große Distanzen zukommen lassen können. Trompeten nützen sie nur in der Nähe, etwa bei Begrüßungszeremonien.
Die aktuelle Studie der US-Forscher kennt Stöger gut -sie hat sie begutachtet. Denn um es in eine angesehene Fachzeitschrift wie Nature zu schaffen, braucht es die kritische Begutachtung von Fachkollegen. Stöger freut sich, dass in dieser Untersuchung erstmals in der Lauterforschung der Elefanten Künstliche Intelligenz (KI) im Einsatz war. Trotzdem ist sie skeptisch: "Die Forscher konnten nicht zeigen, dass für ein Individuum innerhalb einer Herde immer der gleiche Name verwendet wird." Wenngleich die Elefanten einander also offenbar Namen geben, sei nicht zweifelsfrei geklärt, wer der Empfänger eines Rufes ist.
Stöger zieht als Vergleich ein Beispiel aus dem Tiergarten Schönbrunn heran: "Das ist, als würde Tonga ihre Tochter Mongu rufen und ein anderes Mal Drumbo Mongu rufen - aber mit unterschiedlichen Namen ", sagt sie. Tatsächlich ergibt die aktuelle Studie also: Die Elefanten adressieren einander, um sich zu verständigen -aber nützen dafür nicht immer dieselben "Namen". Diese Abweichungen könnten Spitznamen sein. "Aber der Vergleich hinkt", sagt Stöger. Außerdem: Die Stichprobe der neuen Studie sei mit 469 analysierten Lauten zu klein, das Ergebnis medial aufgebauscht.
Nur bei einem ist sich Stöger sicher: Die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, auf der diese Studie basiert, eröffnet der Erforschung von Tierlauten völlig neue Möglichkeiten. Auch deshalb ist geradezu ein Hype um diese Methode entstanden.
In den USA gibt es etwa die Non-Profit-Initiative des "Earth Species Project". Sie will mittels maschinellen Lernens Tiersprachen "entschlüsseln". Bekannt wurde das vor allem in der Walforschung (siehe Kasten Seite 45). Auch Stöger selbst bekomme derzeit laufend -wie viele andere Forschende, die auf einem empirischen Datenschatz sitzen -Anfragen aus aller Welt, ihre Daten für Auswertungen zur Verfügung zu stellen. Doch damit ist sie vorsichtig: "Manchmal sind diese Datensätze ein ganzes Lebenswerk - in meinem Fall 20 Jahre Feldarbeit, in die ich viel Geld, Schweiß und Nerven gesteckt habe." Das soll nicht in falsche Hände geraten.
Rund 12.000 Laute von mehreren hundert Individuen aus verschiedenen afrikanischen Nationalparks hat Stöger gesammelt. Dafür arbeitet sie mit einer sogenannten akustischen Kamera: Dutzende Mikrofone, montiert auf einem großen Stativ, stehen dann in der Nähe eines oder mehrerer Elefanten. So wird sichtbar, wie und wie laut ein Elefant vokalisiert.
Die Daten will Stöger nun selbst mittels KI auswerten. Die Anwendung durchforstet sie nach Mustern. Das kann man sich so vorstellen: Elefanten vokalisieren gern gemeinsam, etwa beim Begrüßungschorus, wenn die Herde nach dem Fressen wieder zusammenkommt. Mittels KI ließe sich erkennen, ob die Tiere zum Beispiel immer in der gleichen Reihenfolge in diesen Chor einsetzen.
Die Anwendung hat aber Grenzen: "12.000 Laute klingt viel, ist es aber gar nicht, wenn maschinelles Lernen darauf angewandt wird", so die Forscherin, verglichen etwa mit Daten aus der Medizin. Diese 12.000 vorhandenen Laute sind annotiert, das heißt, es ist zu jedem bekannt, wann und wo er aufgenommen wurde, oft auch von welchem Individuum welchen Alters er stammt, ob Weibchen oder Männchen: "Rief die Matriarchin, also die Herdenchefin, zum Aufbruch, nachdem alle ihren Durst am Wasserloch gelöscht haben? Wollte ein Kalb trinken?", sagt Stöger, da gebe es nämlich einen eigenen "suckle intention call"."Oder mussten die Tiere das Fressen unterbrechen, weil sie gestresst waren?"
Aufregung ist bei Elefanten übrigens sehr gut daran erkennbar, dass die sogenannte Temporaldrüse an ihrer Schläfe ein Sekret absondert, das dann über die Wange herabrinnt. Stöger hat Szenen aus Elefantenleben oft genug im natürlichen Lebensraum beobachtet, um Laute generalisieren zu können. "Wenn ich einen Elefantenlaut höre, ohne etwas darüber zu wissen, kann ich dennoch einschätzen, wie alt das Individuum war und in welchem Erregungszustand er oder sie sich befand." Ihr Erfahrungswissen ist quasi auch durch maschinelles Lernen entstanden -maschinelles Lernen im Kopf.
Generell erkennen Menschen Stress bei Tieren ziemlich gut. Stöger hat 2017 zu einer Studie beigetragen, bei der den Versuchspersonen Jungtierlaute von Großen Pandas und Elefanten aus Schönbrunn, aber auch von Fröschen, Alligatoren, Raben, Hausschweinen, Berberaffen und Menschenkindern vorgespielt wurden -im gestressten und ungestressten Zustand. Das Ergebnis: Die Getesteten waren sehr gut imstande, nur anhand eines Lautes den Grad der Aufregung des Tieres einzuordnen.
Viel schwieriger hingegen ist die Bedeutung eines Lautes zu erkennen: Wer soll mit einem Kontaktruf angesprochen werden? Oder wie Stöger sagt: "Woher weiß ein Elefant, wenn ein tieffrequenter Rumble-Laut kommt, ob das nun heißt ,Alles gut?' oder ,Hallo, Jenny!'? Das lässt sich mit bioakustischen Methoden kaum herausfiltern." Anhand eines Spektrogramms, der grafischen Darstellung des Lautes, kann sie erkennen, ob der Laut aus dem Maul oder der Nase kommt - Elefanten "sprechen" mit beiden Organen. "Aber ich könnte daraus keine Bedeutung ableiten."
Dass es eine solche Bedeutung aber gibt, da ist sich Stöger sicher. Denn die Tiere reagieren ja auch unterschiedlich darauf. Nur können Menschen diesen Code einfach noch nicht lesen. "Da muss es noch Dimensionen geben, die wir mit unseren Mitteln bisher nicht erfassen konnten", sagt Stöger. "Da sind noch so viele Fragezeichen."
An dieser Stelle kommt wieder Künstliche Intelligenz ins Spiel: Gemeinsam mit ihren Kollegen, dem Mathematiker Peter Balazs (ÖAW) und dem Informatiker Matthias Zeppelzauer vom Institut für Creative Media Technologies der FH St. Pölten, setzt sie gerade ein vom Wiener Wissenschafts-, Technologie-und Forschungsfonds gefördertes Projekt um. "Wir hoffen, dass die Algorithmen dabei Dinge herausfinden, die wir nicht erkennen", sagt Stöger.
Soll heißen: Die KI kann möglicherweise aus einem Schallsignal Parameter herauslesen, die menschlichen Ohren bisher verborgen blieben. Oder die unsere -durch das Menschsein eingeschränkten -Gehirne nicht erkennen. "Wir Menschen haben unsere Sprache, und auch unser Gehirn funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise", sagt Stöger. "Aus diesem human bias kommen wir einfach nicht raus."
Als vermeintliche "Krone der Schöpfung" sind wir Menschen schließlich stark von uns selbst eingenommen und übersehen, dass andere Arten auch einiges draufhaben. Gleichzeitig ist es ein uralter Menschheitstraum, die Sprachen der Tiere zu verstehen. Forschung wie jene von Stöger zeigt, dass viele Tiere komplexere Kommunikationssysteme haben als geahnt.
Die KI soll uns dem Traum nun näher bringen: Sie analysiert einerseits die Laute im jeweiligen Verhaltenskontext -etwa der eines Jungtiers beim Fressen, mit abgespreizten Ohren, was Aufmerksamkeit signalisiert. Andererseits werden die Laute auch ohne solche Annotationen in das System eingespeist und die KI ganz offen gefragt: Wie würdest du die Laute ordnen? Stöger ist sehr gespannt auf die Ergebnisse: Erkennt die KI verschiedene Laute aus dem gleichen Kontext? Deckt sich das mit den bisherigen Daten der Forscher, oder entdeckt sie vielleicht sogar neue Muster?
Sollte das der Fall sein, möchten Stöger und ihr Team eine Art Sprachassistent für die Tiere, ein "Elefanten-Siri", entwickeln: computergenerierte Elefantenlaute. Zuerst spielen sie dann vor freilebenden Tieren echte Elefantenlaute über riesige Subwoofer ab -und dann plötzlich einen computergenerierten. Reagieren die Elefanten darauf überrascht, dürften sie den Laut als "künstlich" erkennen.
Im zweiten Schritt geht es dann um Fragen wie: Verstehen die Elefanten den vorgespielten Laut auch als das, was KI und Forscher darin hören -zum Beispiel eine Begrüßung? Reagieren sie ebenfalls, etwa mit einem Begrüßungslaut? Je nach ihrer Reaktion können die Computer-Laute dann weiter verfeinert werden -und es kann so im Bestfall eine künstliche Elefantencomputerstimme entstehen, wie bei Siri.
So könnten sich nach und nach auch Bedeutungen einzelner Elefantenlaute entschlüsseln lassen. Manchmal wird Stöger dafür kritisiert, auch Zootiere, also nicht freilebende Elefanten, für ihre Forschung zu nutzen. Gerade solche Untersuchungen wären mit völlig wilden Tieren -deren Lebensraum mittlerweile extrem eingeschränkt ist - aber nicht möglich, sagt sie. Sie sieht in ihrer Forschung in Nationalparks und Reservaten einen Weg, zur Wertschätzung der Elefanten und damit zu deren Schutz beizutragen.
Bei all der bioakustischen Forschung dürfen wir eines nicht vergessen, so Stöger: Dass Menschen die Kommunikation mit Lauten wohl vor allem deshalb so interessiert, weil sie für uns selbst so wichtig ist. Elefanten kommunizieren allerdings multimodal: Auch ihre Gestik mit Körper, Ohren und Rüssel, sowie Pheromone und Gerüche spielen eine riesige Rolle - Elefanten haben immerhin den besten Geruchssinn im ganzen Tierreich.
Und so wissen die Forscher schon jetzt, dass sie selbst mithilfe von KI wieder an ihre menschlichen Grenzen stoßen werden, sagt Stöger. "Ganz so schnell werden wir die Tiersprachen nicht verstehen." Vielleicht ist das ja etwas charakteristisch Menschliches: die eigenen Limits erkennen zu können. F
Die Geschichte geht so: Ein Taucher kommt an die Wasseroberfläche und fragt überrascht, wer ihn zum Auftauchen aufgefordert hat. Doch kein anderer Mensch befindet sich im Becken. Sehr wohl jedoch Noc, ein Belugawal der National Marine Mammal Foundation in San Diego, Kalifornien. Irgendwie hatte er es geschafft, Geräusche zu produzieren, die wie eine menschliche Unterhaltung klangen. Es gelang ihm so gut, dass ein Mitarbeiter glaubte, aus dem Becken geschickt worden zu sein.
Das ist 40 Jahre her. Doch noch heute zerbrechen sich Forschende darüber den Kopf. Denn die üblichen Geräusche, die Belugawale erzeugen, liegen um mehrere Oktaven höher. Also muss Noc den Druck in seinem Nasaltrakt verändert und Muskeln und Höhlungen in seinem Kopfbereich eingesetzt haben, um so zu klingen wie ein Mensch. Vielleicht, so die Forscher, um mit seinen Betreuern in Kontakt zu treten.
Nocs Geschichte lässt uns Menschen seither grübeln, ob wir als einzige Wesen in komplexen Systemen miteinander kommunizieren. Und falls nein, ob die riesigen Meeressäugetiere die nächstbesten Kandidaten sind. Verwundern würde es einen schließlich nicht. Nicht nur, weil Pottwale das größte Gehirn aller Lebewesen haben, es Anzeichen dafür gibt, dass Buckelwale Werkzeuge herstellen (Luftblasen, um Krill und kleine Fische zusammenzutreiben), ihre Beziehungssysteme äußerst komplex sind. Sondern auch, weil viele Arten eigene Kommunikationssysteme entwickelt haben.
Sie kommunizieren via Klicklaute miteinander und suchen mit Echolokation nach ihrem Futter (die Klickgeräusche der Pottwale nannte ein Forscher einmal "ziemlich intensive Furzgeräusche"). So sehr ähnelt die Lebensweise der Pottwale dem menschlichen Verständnis des Zusammenlebens, dass viele Forschende sogar von "Walkultur" sprechen. Etwa weil sie via sprachliches Lernen Informationen an die nächste Generation weitergeben, Geräusche imitieren können und sogar lokale "Dialekte" von sogenannten Codas existieren. So nennt man die rhythmischen Sprachmuster der Pottwale, je nach Clan eine unterschiedliche Abfolge an Klicks. Manche dieser Codas könnten hunderttausende Jahre alt sein. Älter als Sanskrit.
Den Forschern geht es nun nicht mehr nur darum zu verstehen, wie diese Kommunikation funktioniert, sondern eine für den Menschen entscheidende Frage zu stellen: Könnten wir, sobald wir "Walisch" verstehen, auch mit ihnen "sprechen"? Der Biologe David Gruber hat zum Beispiel das Projekt CETI gegründet und 33 Millionen Dollar aufgebracht, um eine Hightech-Anwendung zu erstellen, die "Walsprache" lernen kann. Seine Kolleginnen und Kollegen sammeln nun Milliarden an Walklickgeräuschen, eine Künstliche Intelligenz durchforstet diese dann und sucht nach Mustern. Wer diese kennt, könnte sie theoretisch den Walen vorspielen - und auf eine Antwort hoffen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: