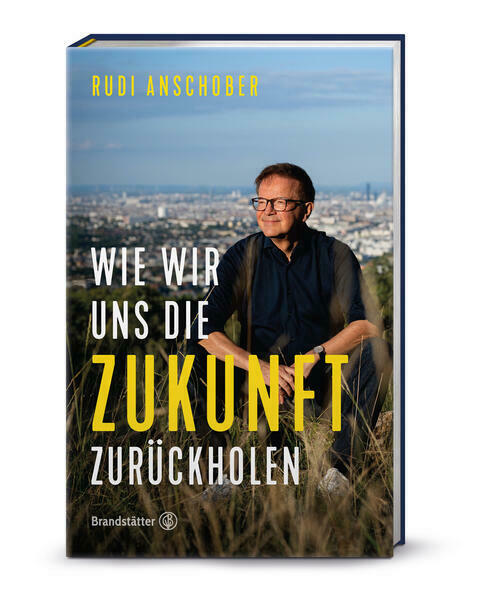C'est la transformation!
Rudolf Anschober in FALTER 30/2024 vom 24.07.2024 (S. 37)
Der Schnurbaum wirft seinen Schatten auf die Rue des Martyrs, bunte Sträucher, gelbe Stauden, Kräuter, Hundsrosen und violette Disteln sind im zwei Meter breiten und zehn Meter langen Beet dicht gepflanzt.
Nach einem kleinen Durchlass folgen weitere Teile dieses duftenden grünen Bandes bis ans Ende einer der ältesten Straßen von Paris, die ihren Namen von der Erzählung des letzten Weges des ersten Pariser Bischofs Saint-Denis hinauf zu seiner Hinrichtung nach Montmartre, dem Märtyrerberg, hat.
Die Bäume wachsen rasch, ihre Spitzen verbinden sich bereits und bilden ein erstes grünes Dach, unter dem ich mit meiner Gesprächspartnerin Monique entspannt bei einem Café Serré sitze und den leichten Luftzug genieße.
Seit einem Jahrzehnt arbeitet die Stadt Paris daran, den öffentlichen Raum neu zu verteilen, Emissionen zu verringern und die Stadt durch Begrünung zu kühlen.
Der Rückbau der Straße der Märtyrer schränkt den Platz für Autos stark ein und schafft viel Raum für Fußgänger, Radfahrer und Grün. Sonntags ist die Durchfahrt durch das Programm Paris Respire ganz gesperrt. Dann besetzen ab und zu Anrainer mit kleinen Tischen zum gemeinsamen Mittagessen Teile ihrer Straße, die immer mehr zum Lebensraum wird. Vor wenigen Minuten habe ich hier die Krankenpflegerin Monique kennengelernt, schon erzählt sie mir, wie es los gegangen ist mit der Transformation von Paris.
"Neben der Pandemie war canicule die schlimmste Zeit meines Berufslebens. Mitte August 2003 wurden immer mehr Menschen in unser Spital eingewiesen, vor allem Ältere. Kreislauf, Herz, Hitzeschläge, viele überraschende Todesfälle. Aber erst als die Bestatter alarmierten, dass sie mit ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen, die Leichenhäuser überfüllt waren und einzelne Kühlhäuser des Gemüsefrischmarktes Rongis die vielen Toten aufnehmen mussten, wurde klar, dass die tagelange Hitze zu einer Katastrophe geführt hatte."
Canicule, übersetzt die "Affenhitze", forderte 2003 in Europa 70.000 Todesopfer, Paris war am stärksten betroffen. 39,5 Grad und die doppelte tödliche Falle einer stärker als New York oder Delhi verdichteten Großstadt sowie die klassischen dunkelgrauen Zinkdächer, die sich bei Hitze auf bis zu 80 Grad aufheizen. "Die Zahl der Hitzetage", schreibt das Fachblatt Lancet Public Health, "steigt durch die Klimakrise schnell an -in Europa doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Schon in den letzten zehn Jahren waren es 45 Prozent mehr als im Jahrzehnt davor. Westeuropa ist besonders gefährdet, denn hier leben viele verletzliche Menschen - Ältere, Vorerkrankte, Bewohner größerer Städte."
Für Paris ist das Risiko am größten. Vor rund 100 Jahren entwarfen Stadtplaner und Architekten gemeinsam mit Renault und Peugeot den Plan Voisin. Seine schlimmste Vision, der Abriss des mittlerweile angesagtesten Pariser Stadtteils Marais, wurde zwar verhindert, aber die Ideologie der autogerechten Stadt wurde jahrzehntelang konsequent umgesetzt; sogar das Ufer der Seine wurde zur Schnellstraße degradiert.
Paris leistet einen Beitrag für Klimaschutz, bereitet sich aber auch auf die Folgen der Klimakrise vor, etwa durch eigene Katastrophenübungen. Temperaturen wie heute in Sevilla, ja sogar 50 Grad werden mittelfristig als Hitzespitzen befürchtet. Wenn zu wenig gehandelt wird.
Ein Freitagnachmittag Mitte Juli. Ich bin mit dem Fahrrad am Weg zum Hôtel de Ville, dem Pariser Rathaus. Die Rue de Rivoli, eine der wichtigsten städtebaulichen Achsen, wurde vor vier Jahren von einer drei Kilometer langen, zwanzig Meter breiten Autopiste in ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer umgebaut, auch hier ist die Umverteilung des Raumes der Schlüssel. Radfahrer und Fußgänger haben viel Platz gewonnen, geschätzt ein Viertel bleibt den Autos, vor allem Taxis und Bussen.
Ein Klingeln und Surren liegen in der Luft, die Nebenstraßen links und rechts sind grün verwachsen, viele für den Verkehr gesperrt. Es ist eine Freude, sicher und mit ausreichend Platz schnell ans Ziel zu kommen. 16.000 sind hier täglich mit ihrem Fahrrad unterwegs, Angebot schafft Nachfrage
Wie in Brüssel, Amsterdam, Lyon oder Marseille kamen durch die grüne Welle des letzten Jahrzehnts auch in Paris Grüne in Regierungsfunktionen -mit dem gemeinsamen Ziel der Klimawende in ihren Städten.
Im vierten Stock des Rathauses treffe ich David Belliard, den Vizebürgermeister für Transformation, er schildert die ersten Auswirkungen des Umbaus: Erstmals werden in der Stadt deutlich mehr Wege mit dem Rad als mit dem Auto zurückgelegt, keine fünf Prozent sind es mit dem Auto, über elf mit dem Fahrrad, 53 Prozent der Wege werden zu Fuß bewältigt. Immer weniger Menschen besitzen ein Auto, und selbst die lassen es meist stehen.
David, wie setzt ihr diese Transformation um?
"Mut, Klarheit und Konsequenz statt fauler Kompromisse. Wer es allen recht machen will, verliert die Glaubwürdigkeit, die Zukunft, die Zeit und die Bevölkerung. Wir haben klare Ziele festgelegt, wir wollen durch 70.000 weniger oberirdische Parkplätze -eine Halbierung! - Platz für 155.000 neue Bäume und damit für Kühlung schaffen. Rund die Hälfte haben wir schon verwirklicht -ein einziger großer Baum kann an einem Sommertag 400 Liter Wasser verdunsten und damit so viel Kühlung erzeugen wie zehn Klimaanlagen. Viele Anrainer und Verkehrsteilnehmer verstehen den Nutzen, sehen die Verbesserung ihrer Lebensqualität und damit ist die Tür geöffnet für das Ausrollen der Leuchttürme in der ganzen Stadt."
Fundamentale Gegner der Pariser Klimawende sind nur mehr die rechtsextremen Lepenisten, die mit Wahlergebnissen im einstelligen Bereich hier in Paris wenig Bedeutung haben.
Am Sonntagmorgen wandere ich in den Norden der Stadt nach Belleville, vorbei an vielen Orten der Transformation. 550 Kilometer neue Radwege, meist einladend breit, wurden in den letzten zehn Jahren errichtet. Paris setzt jedoch nicht nur neue Maßstäbe für den Radverkehr, sondern forciert auch das Gehen.
Auffallend sind neben dem vielen Platz für Fußgeher die dämpfende Wirkung von Tempo 30 (ja, es gibt Ausnahmen, aber die Stadt wird geprägt von diesem geringeren Tempo), die vielen Begegnungen und auch die neuen Toilettenpavillions auf den Boulevards, die nicht nur hübsch, sondern auch hygienisch und gut erreichbar sind.
Belleville ist eines der spannendsten Viertel von Paris, ein Arbeiterbezirk, Ort der Revolution, hier hielt sich die Pariser Kommune am längsten.
Rasch komme ich zur rue aux école, einer von mittlerweile mehr als 200 Schulstraßen. Es sind Fußgängerzonen im Umfeld von Kindergärten und Schulen, stark bewachsen, viele bieten einen großen Wasserspender. Die Ferien haben längst begonnen, aber weiterhin spielen Kinder hier auf der Straße, die ihnen Sicherheit gibt und Gesundheit ermöglicht.
Auch das ist das neue Paris: die Menschen und ihre Zukunft im Mittelpunkt einer Stadt, die zur 15-Minuten-Stadt werden will. Durch Dezentralisierung, Durchmischung, Vielfalt sollen Verwaltung, Bildung, Kultur und Arbeitsplatz innerhalb einer Viertelstunde per Rad erreichbar sein. Das Gegenkonzept zum Plan Voisin, der Paris durch Entflechtung aller Lebensbereiche zur Autostadt machte.
Natürlich gibt es auch Verzögerungen und Schwierigkeiten. Etwa durch den Denkmalschutz, der auf den charakteristischen dunklen Zinkdächern beharrt, obwohl ein aktueller Pilotversuch in einer Schule gezeigt hat, dass weiße Dächer mehrere Grad an Temperatur einsparen können. Auch die zu geringe Sanierungsrate macht Experten Sorgen, zersplitterte politische Strukturen, vor allem aber die soziale Ungleichheit und die weiterhin zu hohen Mietpreise, die die Wohnungslosigkeit vergrößern.
Vielfach bringt Olympia wichtige Impulse für den weiteren Umbau: Die für die Zeit der Spiele geschaffene Olympia-Spur auf der Ringautobahn Périphérique wird später in einem ersten Schritt des Umbaus zum Fahrstreifen für Fahrgemeinschaften, das Ufer der Seine, das vor wenigen Jahren von Autos befreit wurde, wird nach der für Olympia um 1,4 Milliarden Euro durchgeführten Sanierung des Flusses zum Plage Paris, die "Prachtstraße" Champs Élysée wird nach der Sperre während der Spiele in breite Boulevards und Begegnungszonen mit 250 neuen Bäumen sowie optimalem Radverkehr umgebaut.
Ich fahre mit der neu verlängerten Metrolinie 14 bis zum Vorort Saint-Denis, in dem ein Großteil der Olympischen Spiele stattfindet. Der soeben fertiggestellte Bahnhof wird Knotenpunkt der nächsten Stufe der Transformation. Bis 2031 soll die 200 km lange Strecke des neuen fahrerlosen Grand Paris Express durchgehend in Betrieb sein.
Die neue Bahn zieht keine Stichstrecken in das Stadtzentrum -ein Konzept, das viele Metropolen hoffnungslos überfrachtet hat -, sondern führt durch die Vororte um Paris herum und verbindet sich jeweils mit den Metrostrecken der Stadt.
Die Idee ist überzeugend: das Stadtzentrum entlasten, Pendlerbewegungen auf den öffentlichen Verkehr verlagern und verringern, Wirtschaftsimpulse außerhalb des Zentrums von Grand Paris mit seinen insgesamt zwölf Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern setzen.
Dennoch wirkt David Belliard nachdenklich: "Frankreich ist zunehmend gespalten in Stadt und Land, reich und arm, City und Grand Paris. Wir haben wenig Erfahrung mit Koalitionen, das Mehrheitswahlrecht hat uns nun in das Patt geführt, das es verhindern sollte. Wir müssen lernen, Brücken zu bauen."
Eine besondere wurde vor wenigen Tagen in Saint-Denis im Zentrum von Olympiade und Banlieues eröffnet. Über lange Zeiten hatten die dutzenden Gleise der Nordbahn die Region entzweit, seit Jahrzehnten wurde eine Fußgängerbrücke gefordert. Die verweigerte Brücke war Symbol für die fehlende Wahrnehmung der Bedürfnisse der Vororte.
Die spektakuläre 300 Meter lange Holzbrücke, errichtet in der Funktion einer italienischen Bürgerbrücke, soll durch ihre Breite von 28 Metern nicht nur Verbindung, sondern auch Ort der Begegnung, Gastronomie-und Kulturstätte werden. Das Bauwerk, das an das Skelett eines riesigen Walfisches erinnert, wird die sozialen Probleme nicht wesentlich verändern, aber könnte zum Symbol einer neuen Verbindung innerhalb dieser gespaltenen Gesellschaft werden.
Damit der ökologischen auch eine soziale Transformation folgt.
Anschobers realistische Utopie
Barbaba Tóth in FALTER 22/2024 vom 29.05.2024 (S. 21)
Rudi Anschober, vielen als strauchelnder grüner Gesundheitsminister während der Pandemie in Erinnerung, wendet sich in seinem neuen Buch seinem eigentlichen Lebensthema zu: dem Kampf um ein sozial gerechtes, ökologisches, besseres Leben. Seine harten Erfahrungen in der Pandemie hatte er schon 2022 literarisch in "Pandemia" (erschienen bei Hanser) verarbeitet. Auch damals mischte er Realität mit Fiktionalem, was - angesichts der Wucht der Corona-Zeit und seiner Schlüsselrolle in der Regierung -nicht immer aufging.
Ähnlich geht Anschober nun auch in "Wie wir uns die Zukunft zurückholen" (Brandstätter) vor. Aber diesmal passt die von ihm bevorzugte Mischung aus tatsächlich passierten Ereignissen und harten Fakten und literarischer Fantasie. Wenn man so will, kreiert der Autor Anschober, der früher als Pädagoge und Journalist gearbeitet hat, sein eigenes Genre des utopisch-realistischen Sachbuchs.
Anschober beamt uns am Beginn seines Buches in den Mai 2040, er ist 80 Jahre alt, Wien eine klimafitte, entfossilierte, autobefreite Musterstadt -fast zumindest. Denn während der Autor mit seinem Hund Belami durch sein Grätzel spaziert, entlang an Alleen, Teichen, wieder ausgegrabenen Flüssen, hängenden Gemüse-und Obstgärten und Fahrradautobahnen, entdeckt er rassistische Slogans an einer Hausfassade. Gegen die Klimaflüchtlinge, die sich Österreich verpflichtet hat, aufzunehmen und auszubilden.
Wie kamen wir dorthin? Das erzählt uns Anschober im Rest des Buches, zur Orientierung helfen Jahreszahlen auf jeder Seite. 2025 ermächtigt die UNO die Weltklimakonferenz, mit qualifizierter Mehrheit konkrete Beschlüsse zu fassen. Der Sommer 2026 wird zum "schwarzen Sommer", zum globalen Umweltkatastrophenjahr. Damit ist auch die Einsicht da, dass das Klimathema kein Luxusproblem ist, sondern eine soziale Frage. Klimabewegungen gewinnen die Wahlen - und ab dann geht's dahin. Ein lesenswertes Gedankenexperiment.