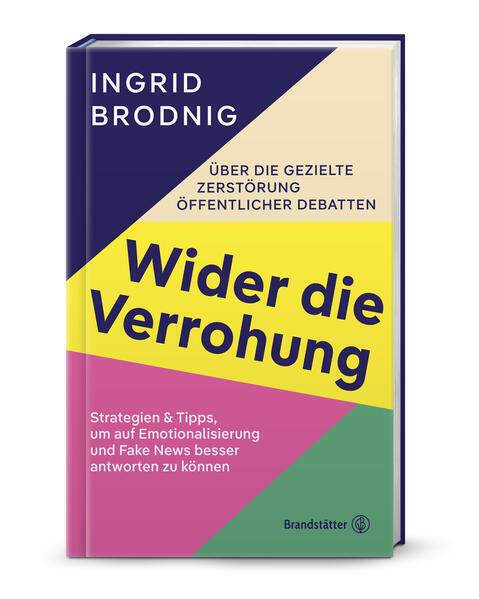"Wenn schon wütend, dann achtsam wütend"
Nina Horaczek in FALTER 30/2024 vom 24.07.2024 (S. 21)
Ein Politiker, der Politikerinnen als "Hexen" beschimpft und sie die Peitsche spüren lassen möchte. Der Wahlkampf für die Nationalratswahl am 29. September hat offiziell noch nicht begonnen. Aber einen Vorgeschmack darauf, was da droht, gab der FPÖ-Politiker Harald Vilimsky mit seinen Beschimpfungen der drei starken EU-Frauen -Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und Zentralbank-Präsidentin Christine Lagarde. Der Ton wird bis zur Wahl wohl noch rauer werden.
Was hilft, wenn einen die Wucht der meist negativen Nachrichten verzweifeln lässt? In ihrem neuen Buch "Wider die Verrohung" zeigt die Publizistin und Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig, wieso politische Debatten oft so brutal sind, und verriet dem Falter die wichtigsten Tipps, um sich zu schützen.
1 Die Welt ist gar nicht so düster Wer regelmäßig auf Social Media unterwegs ist, hat schnell das Gefühl, die Welt geht bald unter. Die US-Psychologin Molly Crockett untersuchte, wie sehr Menschen, die sich davor über das Internet informiert hatten, Wut und Ekel spüren, und dieses Bild verglichen mit Menschen, die zuvor Zeitungen, Radio und konventionelles Fernsehen konsumierten. Die Online-Gruppe war viel stärker moralisch entrüstet. Dabei zeigt uns das Internet nur einen Ausschnitt der Welt, und der ist sehr oft sehr schlimm. Die Algorithmen, die uns durchs Internet führen, sind echte Drama-Maschinen. Was aufregt, führt oft zu vielen Interaktionen, und da denkt sich der Algorithmus womöglich, da ist was los, das zeige ich an.
Außerdem gibt es online eine starke Verzerrung. Dabei wird der Großteil der online geposteten Inhalte von einer kleinen Minderheit verfasst. In Österreich analysierte das Onlinemagazin mokant.at im Nationalratswahlkampf 2017 2,9 Millionen Postings von 40 Seiten aus Politik und Medien. Die Hälfte dieser Postings stammte von nur 8900 Userinnen und Usern. Man kann davon ausgehen, dass die meisten Social-Media-User gar nicht oder nur selten Politisches kommentieren, eine winzige Minderheit aber extrem viel. Solche Überzeugungstäter gab es immer. Aber jetzt haben sie die Chance, alle zuzuspammen. Deshalb ist das, was ich auf Social Media sehe, nicht die Welt, wie sie ist. Wer das im Kopf hat, regt sich viel weniger auf.
2 Nicht auf Fake News reinfallen Oft ist es schwer zu erkennen: Was ist richtig und was falsch auf Social Media? Fake News funktionieren nach zwei Mechanismen. Zum einen dem Wunsch nach Bestätigung. Was meinem eigenen Weltbild entspricht, teile ich schneller. Dieses Phänomen findet sich in allen politischen Lagern. Ein Beispiel: Im Netz tauchte ein Bild auf, das den deutschen CSU-Politiker Markus Söder mit einem Blumenstrauß zeigt. Angeblich am Weltfrauentag. Das ist total abgegangen. Was für ein antiquiertes Frauenbild! Wir Frauen wollen Gleichstellung, keine Blumensträuße! Das Posting war ein Fake. Aber weil es so vielen ins Weltbild passte, dass ein konservativer Politiker keine Ahnung vom Weltfrauentag habe, wurde es fleißig geteilt. Deshalb: Gerade wenn ich völlig überzeugt bin, dass etwas stimmen muss, weil es meinem Weltbild entspricht, extra noch einmal hinterfragen: Berichtet auch eine zweite Quelle über den Vorfall?
Der zweite Mechanismus ist Wut. Fake News regen auf. Deswegen sind sie so erfolgreich. Manche Emotionen verengen den Blick. Wer wütend ist, denkt nicht mehr logisch. Da gehen dann Lügen über Personenkreise, denen ich ohnehin schon eher ablehnend gegenüberstehe, besonders gut rein. Ein wesentliches Ziel von Fake-News-Erzeugern ist auch, zu verunsichern. Als russische Raketen kürzlich ein Kinderspital in der Ukraine zerstörten, wurden auf russischen Kanälen Behauptungen verbreitet, das sei eine Abwehrrakete der Ukrainer gewesen oder es handle sich um Schauspieler. Man bringt einfach so viele verschiedene Erzählungen ins Spiel, damit die Menschen am Ende das Gefühl haben, sie kennen sich jetzt gar nicht mehr aus. Obwohl Fachleute es als "sehr wahrscheinlich" bezeichnen, dass dieses Krankenhaus von russischen Truppen bombardiert wurde.
3 Umgehen Sie die Empörungsfalle Ja, vieles, was wir auf Social Media sehen, macht wütend. Aber oft wird eine Provokation gezielt gesetzt, damit wir uns empören. Weil wer sich ärgert, reagiert oft auch. So bekommen diese Provokationen mehr Reichweite. Ein harmloses Beispiel: Es gibt einen Influencer, der sich gut mit Kaffee auskennt. Der sagt regelmäßig statt Espresso "Expresso". Dann posten viele darunter, dass das falsch ist. Und schon steigt die Reichweite. Habe ich erst verstanden, dass Wut ein Köder ist, kann ich taktisch mit meiner eigenen Wut umgehen. Also mich erst einmal fragen: Will ich jetzt wirklich auf die provokative Aussage von Politiker XY einsteigen oder nicht? Oft ist es besser, statt so eine Provokation noch mit einem Empörungsposting zu adeln, indem ich ihr mehr Reichweite verschaffe, lieber gar nicht zu reagieren. Und wenn doch, dann lieber auf die Metaebene gehen und für die anderen Userinnen und User offenlegen, was die eigentliche Intention hinter so einer Provokation sein kann.
4 Wut ist okay, aber bitte achtsam Wut wird oft verteufelt. Aber sie ist per se nichts Schlechtes. Es ist völlig legitim, sich etwa über Ungerechtigkeiten oder über rassistische Vorfälle im Netz zu empören, etwa wenn ein Politiker über eine Minderheit brutal drüberfährt. Da wird es in den kommenden Wochen online und offline viel geben, das aufregt. Aber wenn schon wütend, dann achtsam wütend. Bevor Sie auf solche Vorfälle reagieren, nehmen Sie sich erst einmal Zeit, den eigenen Körper zu scannen: Wie fühle ich mich? Verspannt sich mein Körper gerade, sind die Schultern unlocker und meine Gesichtsmuskeln verkrampft? Da signalisiert mir mein Körper, dass mich das, was ich gerade gelesen habe, sehr aufregt und emotional mitnimmt. In solchen Momenten neigen wir zu Kurzschlussaktionen. Und sind auch nicht gerade in eloquenter Höchstform. Hören Sie auf Ihre Körpersignale, nehmen Sie sich Zeit, bis die Anspannung sich gelöst hat und reagieren Sie erst, wenn Sie wieder in der Lage sind, strategisch zu denken. "Wut achtsam einsetzen" nennen das die Wissenschaftlerinnen Whitney Phillips und Diane Grimes.
5 Appellieren Sie an die Empathie Wenn man die Empathie von Menschen berührt, kann man zum Teil ein Einlenken bewirken. Der Wissenschaftler Dominik Hangartner hat dies in zwei Studien beobachtet. Dabei wurden Menschen kontaktiert, die zuvor rassistische Inhalte gepostet hatten, und es wurden unterschiedliche Techniken getestet. Eine davon war die Erinnerung an die Empathie: Wie verletzend das sein kann, wenn man als Betroffener so eine Äußerung liest. In 8,4 Prozent der Fälle löschten die Leute danach ihre rassistischen Tweets. Solche Interventionen führen nicht dazu, dass sich die Mehrheit ändert. Aber es ist zumindest ein Anfang, wenn eine kleine Minderheit zum Nachdenken animiert wird. Diese Technik kann wirklich jeder und jede anwenden. Gerade auch in privaten Diskussionen mit Andersdenkenden.
6 Den Menschen nicht übersehen Bei manchen Postings oder auch Äußerungen in der Spitzenpolitik denkt man sich: Was ist das für ein furchtbarer Mensch, wie kann man bloß so etwas Herabwürdigendes sagen? Aber selbst wenn man unglaublich wütend ist, sollte man sich auch die Menschlichkeit der anderen Person vor Augen halten. Der war auch einmal ein Kind, hat selbst eine Familie, hat ein Leben und Bedürfnisse. Das bedeutet nicht, dass man diese Person verharmlost. Man kann ihre Aussage oder ihr politisches Wirken trotzdem ablehnen. Aber wenn ich mich daran erinnere, dass auch jemand, den oder die ich zutiefst problematisch finde, ein Mensch ist wie ich, bin ich in meiner Wut weniger eskalierend. Wenn die Wut so weit geht, dass man das Gegenüber entmenschlicht, wird es gefährlich. Das ist der Moment, wo es nicht mehr weit ist zu Gewaltfantasien oder der Verharmlosung von tatsächlicher Gewalt. Wenn wir es ablehnen, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft entmenschlicht werden, sollten wir es schon gar nicht tun. Auch nicht bei Menschen, deren Meinung wir völlig ablehnen.
7 Dem Populismus widerstehen Populismus in seiner Schwarz-Weiß-Logik fördert Schwarz-Weiß-Debatten. Die Schweizer Wissenschaftlerin Sina Blassnig hat gemessen, dass populistische Rhetorik auf Social Media ein besseres Feedback bekommt. Deshalb ist die Verlockung der Politik groß, wie Populisten zu sprechen, weil es sich rentiert. Leider befördern das auch manche Medien, weil sie da bei der Aufmerksamkeit mitnaschen wollen. Der deutsche Kommunikationswissenschaftler Frank Esser hat einige Gedankenanstöße formuliert, die ich auch bei meiner Medienauswahl gerne verwende. Überlegen Sie sich bei Ihrem Medienkonsum einfach: Welches Medium kritisiert nicht nur eine Partei, sondern alle, wenn sie Grenzüberschreitungen begehen? Welches Medium berichtet, wenn etwa Minderheitenrechte oder Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit attackiert werden? Liefert das Medium auch positive Gegenbilder, wie die Gesellschaft verbessert werden kann? Werden populistische Medienstrategie als solche auch erklärt und eingeordnet? Kein Medium wird alle diese Punkte stets erfüllen. Aber es ist für das Publikum eine gute Richtschnur.
8 Solidarität wirkt Wer auf sozialen Medien Hasskommentare erlebt, fühlt sich oft alleine. Hate Speech zielt auch auf den Selbstwert ab. Hier hat das Publikum einen wichtigen Einfluss: Wer Menschen den Rücken stärkt, die sich online gegen Diskriminierung bestimmter Gruppen aussprechen und deswegen angefeindet werden, hilft ihnen dabei. Und trägt dazu bei, dass das Internet zu einem freundlicheren Ort wird. Dafür muss man gar nicht alle Positionen dieser Person teilen. Auch beim Gefühl, es ist unfair, wie diese Person behandelt wird, sollte man Solidarität zeigen.
9 Gönnen Sie sich Pausen Wer viel auf sozialen Medien über Politik mitliest, kriegt eher ein übertrieben negatives Bild davon, wie empört oder gespalten andere Menschen sind. Das beobachtete unter anderem eine Studie des Psychologen William Brady. Die Gefahr ist also, dass man die Welt als einen viel düstereren Ort wahrnimmt. Wenn Sie das, was Sie online über Politik und die Gesellschaft lesen, zu sehr mitnimmt, dann wird es höchste Zeit für eine Pause. Damit meine ich nicht dieses typische "Ich will jetzt gar keine Nachrichten mehr lesen!". Statt pauschal Medien zu boykottieren, kann man sich fragen: Welche Medien oder auch Social-Media-Kanäle betreiben vorrangig Aufklärung? Zum Beispiel sind manche klassischen Qualitätsmedien oder Nachrichtenjournale im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ruhiger und nicht so emotionsgeladen. Wenn Sie danach auf Social Media zurückkommen, suchen Sie sich genau aus, was und wie viel Sie davon konsumieren wollen. Das Gute ist auch: Die Aufregung ist nicht immer gleich groß. Jeder Wahlkampf, vom früheren Wiener Bürgermeister Michael Häupl einmal "Zeit fokussierter Unintelligenz" genannt, ist irgendwann vorbei.