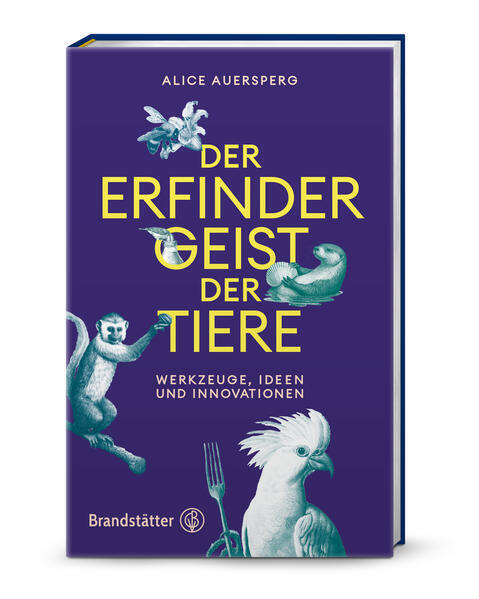Servus Nachbär!
Patricia McAllister-Käfer in FALTER 19/2025 vom 07.05.2025 (S. 43)
Immer wieder brechen Tiere aus Zoos aus. Aber Fred ist einmalig: Im Frühling 2019 brach der Waschbär in den Zoo Heidelberg ein - und zwar ins Waschbärgehege. Tierpfleger entdeckten am nächsten Tag den achten Insassen und mussten ihn behalten. Denn die aus Nordamerika stammenden Waschbären gelten in der EU als "invasiv", könnten also das hiesige ökologische Gleichgewicht stören. Und so durfte Fred nicht wieder in die Freiheit.
Die putzigen Allesfresser breiten sich in Teilen Deutschlands mittlerweile gern aus, verzehren heimische Frösche, Molche, Schlangen und Vögel oder deren Gelege -und bringen die ohnehin schon gefährdete Artenvielfalt weiter unter Druck. Verbreitet, wenngleich nicht so zahlreich, sind die Kleinbären auch in Österreich. Sie sind auffallend neugierig und haben einen ausgeprägten Tastsinn. Mit ihren fünf freistehenden "Fingern" können sie selbst Schraubverschlüsse öffnen.
Kein Wunder also, dass es sie in Städte mit ihrem reichhaltigen Angebot zieht -etwa nach Wien. Gab es bis vor wenigen Jahren noch keine Nachweise von Waschbären, mehren sie sich nun, wie die Initiative Stadtwildtiere bemerkt: Von Bürgern geschossene Fotos, Pfotenabdrücke auf feuchtem Boden oder Fahrzeugen. Auch die MA 49, der Forst-und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt, erfasste in den vergangenen Jahren drei "valide Waschbärsichtungen", alle im Bereich des Wienflusses. Beschwerden über geplünderte Komposthaufen oder Mülltonnen gab es noch nicht.
Eigentlich ist das Leben in der Stadt allein schon aufgrund der vielen Autos gefährlich. Viele wilde Tiere scheinen es trotzdem zu bevorzugen. Warum? Macht die Stadt und der Kontakt mit Menschen die Waschbären nicht nur satter, sondern auch schlauer? Wer mit Fabienne Selinger unterwegs ist, kommt einer Antwort auf diese Frage näher. An einem sonnigen, aber kühlen Märzmorgen streift die Wildtierökologin und "Waschbär-Beauftragte" bei der Initiative Stadtwildtiere durch die Steinhofgründe in Wien Penzing. Eine Kindergartengruppe kugelt am Spielplatz herum, ein zahmes Eichhörnchen stibitzt Kerne aus einem Vogelhäuschen.
Selinger macht darauf aufmerksam: Vielleicht nicht unbedingt hier, aber in praktisch jedem anderen Wald in Österreich glauben wir, auf eine "pristine", also unverfälschte Natur zu blicken -nur gibt es die nicht mehr.
Fast alles in unseren Kulturlandschaften nutzt der Mensch: als Feld, Futterwiese oder Forst. Invasive Arten wie Waschbär und Bisamratte gesellen sich dazu, dafür fehlen größere Beutegreifer wie Wolf oder Bär. Und so haben sie leichtes Spiel.
Waschbären scheuen das Tageslicht, die Tiere sind nachtaktiv. Spuren, dass sie unter uns sind, findet Selinger trotzdem: An einem alten, hohlen Obstbaum bleibt sie stehen. Der Unterschlupf hier am Stadtrand wäre perfekt für Waschbären. Wenige Meter entfernt fließt ein kleiner Bach, eine Streuobstwiese liegt gleich daneben. Die Tiere sind nicht wählerisch, geben sich auch mit Scheune oder Dachboden, einem alten Dachsbau oder Asthaufen zufrieden.
Genau diese Anpassungsfähigkeit ist ein wichtiges Kriterium für ihren Erfolg, meint Selinger. Als wärmeliebende Art kommt ihnen auch der Klimawandel entgegen. Unter günstigen Umständen können die Tiere so bis zu zwei Mal jährlich drei bis fünf Welpen werfen.
Der Waschbär ist jedenfalls nicht der einzige "Kulturfolger" im Stadtgebiet. Auch Ratten oder Tauben halten sich mit Vorliebe in Siedlungsnähe auf, weil sie dort mehr Futter und soliden Unterschlupf finden.
Der Waschbär hat aber noch eine andere Qualität: Er ist besonders intelligent, hat eine ähnlich große Anzahl an Gehirnzellen wie der Hund, allerdings in einem kleineren Gehirn. Seine neuronale Dichte - ein Indikator für Intelligenz - ist also vergleichbar mit Menschenaffen, fand eine Studie im Fachjournal Frontiers in Neuroanatomy heraus.
Waschbären folgen der menschlichen Kultur aber nicht nur, sondern sind auch imstande, sie in größerem Maßstab zu stören. Sie können uns sogar dazu bewegen, unser Verhalten zu ändern oder es zumindest zu überdenken.
Womit wir bei Fred in Heidelberg wären: Ein "freiwilliges" Zootier lässt uns immerhin die penibel gezogenen Ordnungslinien zwischen Natur und Kultur, schmutzig und rein, zahm und wild hinterfragen.
Tatsächlich sind Fred und seine Artgenossen schon seit über 100 Jahren widerspenstig. Anfang des 20. Jahrhunderts wären Waschbären in den USA beinahe eine Modellart zur Erforschung von Gehirn und Intelligenz geworden. Als pfiffige, halbzahme Haustiere waren sie damals auch bei der US-Bevölkerung beliebt.
Den Forschern aber kamen die leichter zu haltenden Mäuse und Ratten gelegener. Die Waschbären bissen regelmäßig die Gitter ihrer Käfige durch und versteckten sich in Lüftungsschächten.
Nach Europa ursprünglich als Zoo-und Pelztier importiert, setzte ein unbekümmerter Züchter zwei Waschbärpärchen 1934 nahe der deutschen Stadt Kassel frei.
Auch später entkamen immer wieder welche aus Haltungen. Mittlerweile leben in Deutschland rund eine Million freilebender Tiere; in Österreich melden engagierte Bürger dem Umweltbundesamt die Waschbären aktuell aus allen Bundesländern (bevorzugt in den Tieflagen in Oberund Niederösterreich). Sie sind aber nach wie vor selten.
Eine entsprechende EU-Verordnung aus dem Jahr 2015 listet sie allerdings immer noch als "invasive gebietsfremde Art". Mitgliedsstaaten müssten sie also eigentlich "beseitigen" oder zumindest in der Ausbreitung kontrollieren. Auch als Haustiere sind sie verboten.
Das Kostbarste für alle Kulturfolger ist jedenfalls unser Müll. Im kanadischen Toronto, das eine Hassliebe zu den Tieren pflegt, setzt die Stadtverwaltung deshalb seit dem Jahr 2016 "waschbärsichere" Mülltonnen ein.
Ein Drehverschluss, so dachten die Verantwortlichen, sei für die Tiere nicht zu knacken. Ihr Daumen ist immerhin nicht "opponierbar", liegt also den anderen Fingern nicht gegenüber.
Weit gefehlt: Eine Journalistin des Toronto Star dokumentierte, wie eine Waschbär-Mama auch diesen Schließmechanismus aushebelte. In Sydney, Australien, sind es freilebende Gelbhaubenkakadus, die in den Mülltonnen stierln. Dort haben Anrainer selbst die Initiative ergriffen - etwa volle Wasserflaschen an den Tonnendeckeln befestigt, um sie zu beschweren.
Forscher hegen deshalb einen Verdacht: Könnten diese als Abschreckung gedachten Maßnahmen die Waschbären und andere urbane Tiere vielleicht sogar schlauer machen?
Alice Auersperg widmet sich genau solchen Fragen. Soeben hat die Kognitionsbiologin ein Buch zum "Erfindergeist der Tiere" veröffentlicht*. Für sie gibt es eine Königsdisziplin tierischer Innovation: Werkzeuggebrauch. Auersperg erforscht etwa Goffin-Kakadus auf der indonesischen Insel Tanimbar.
Die Vögel fertigen dort mit ihrem Schnabel ein dreiteiliges Werkzeugset. Mit Messer, Keil und Löffel versuchen sie, an das Innere des Kerns der Wawai-Frucht zu gelangen - für die Tiere eine Delikatesse. Die Goffin-Kakadus haben auch die Stadt Singapur für sich entdeckt, nachdem sie per Schiff eingeschleppt worden waren.
Auersperg macht den Erfolg im Urbanen vor allem an einem fest: "Stadtbewohner sind üblicherweise opportunistische Generalisten", sagt sie, also höchst anpassungsfähige Allrounder.
Sie sind beim Futter nicht wählerisch. Und sie sind neophil und neophob: neugierig und zugleich vorsichtig. "Um zu entdecken und Dinge auszuprobieren, muss man unbedingt vermeiden, gefressen oder -im Fall der Waschbären - gefangen zu werden", erklärt Auersperg.
Ihre Kollegin Jennifer Colbourne hat in ihrer Heimat Toronto zu Waschbären geforscht. Nun arbeitet auch sie am Messerli-Institut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie glaubt, dass der Erfolg der Tiere auch mit ihrem Körperbau zu tun hat: Waschbären haben Hände ohne richtigen Daumen, aber gerade in menschengemachten Umgebungen sind diese Pratzen nützlich.
"Die Tiere können -etwa im Unterschied zu Füchsen - einen Deckel von einem Schraubglas öffnen." Dazu komme eine extrem flexible Wirbelsäule. Das führt dazu, dass sie in Kanada häufig in zu kleinen Öffnungen feststecken.
Zudem stellt Auersperg in ihrem Buch eine Frage, die uns das Verhalten urbaner Waschbären erklären könnte: Wozu haben manche Tiere im Laufe der Evolution überhaupt ein Gehirn entwickelt? Weshalb leisten auch Menschen sich dieses Organ, dessen Betrieb so viel Energie kostet?
Die Antwort ist verblüffend simpel und erklärt auch, warum es gerade auf Inseln besonders intelligente Arten wie Kakadus gibt: Wer sich ständig neu anpassen muss, benötigt mehr kognitive Flexibilität.
Um neue Futterquellen zu erschließen, weil eine alte versiegt, oder um in einem Wald nach einem Buschfeuer zurechtzukommen. Am Festland könnte eine Tierart einfach weiterziehen, auf einer begrenzten Insel hingegen braucht es mehr Köpfchen. Wer das hat, wird eher überleben, sich fortpflanzen und das eigene Erbmaterial so weitergeben.
Auch in Städten stehen Waschbären vor neuen Herausforderungen: Sie brauchen ihre Intelligenz, um nachzudenken, wie sie mit Unvorhergesehenem umgehen.
Und noch etwas zeichnet Waschbären aus: eine hohe "Persistenz", also das Vermögen, lange an einem Problem dranzubleiben. In den Pilottests der Mülltonnen in Toronto werkelte ein Waschbärweibchen sechs Stunden an deren Drehverschluss herum -allerdings erfolglos.
Nur eines sind Waschbären nicht: "soziale Lerner". Sie geben ihre Fähigkeiten kaum an ihren Nachwuchs oder andere Artgenossen weiter. "Intelligenz bedeutet für jede Spezies in ihrem jeweiligen Lebensraum etwas anderes", sagt Auersperg.
Tauben etwa haben wesentlich kleinere Gehirne als Papageien und lernen in der Stadt wohl wenig dazu. Auch sie sind opportunistische Generalisten, die jede Gelegenheit nutzen, um an Futter zu gelangen -, aber nicht am Problemlösen interessiert.
Kommt das Stadtleben also gerade den Waschbären entgegen? So sieht es die Kognitionsforscherin Colbourne: "In 15 bis 20 Jahren habt ihr in Wien auch eine schöne Waschbärpopulation", lacht sie. Die MA 49 glaubt, dass sie dank ihres Wildtiermanagements eine Zunahme "sofort wahrnehmen würde".
Kulturfolger seien jedenfalls jene Tierarten, so Wildtierökologin Selinger, die in einer immer stärker vom Menschen geprägten Umwelt am ehesten überleben. Waschbären könnten in Zukunft also urbane Mitbewohner werden. Wir müssten uns mit ihnen arrangieren.
Spät, aber doch, werden die Tiere jetzt auch zu Studienobjekten. Allerdings nicht im Labor: In den USA und Europa wird erforscht, wie geschickt Waschbären im Problemlösen tatsächlich sind.
Dazu stellen die Forscher nachts Automaten mit kleinen Fächern auf. Um an Leckerbissen zu gelangen, müssen die Tiere Schlösser öffnen. Die Bilder der Überwachungskameras bestätigen jedenfalls den Verdacht: Wir sehen ziemlich intelligenten Wildtieren dabei zu, wie sie noch schlauer werden.