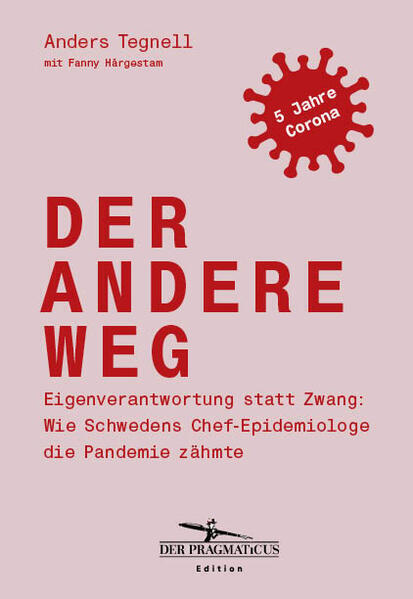"Die Kritiker haben unsere Strategie nie verstanden"
Katharina Kropshofer in FALTER 10/2025 vom 05.03.2025 (S. 18)
Allein seinen Namen zu nennen, stößt auf Widerstand: Anders Tegnell, der ehemalige Chefepidemiologe Schwedens, ist ein umstrittener Mann. Er steht für den "schwedischen Weg": Keine staatlich vorgeschriebenen Lockdowns, weniger gesetzliche Eingriffe. Während der ersten Corona-Welle schnellten die Zahlen der Covid-19-Erkrankten und -Toten auch hier in die Höhe. Wer auf den gesamten Verlauf der Pandemie blickt, kann trotzdem sagen: Schwedens Übersterblichkeit ist niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern.
Was man über Schweden wissen muss: Das Gesundheitssystem ist exzellent, die Impfbereitschaft so hoch wie kaum wo. Kann man einzelne Länder also überhaupt miteinander vergleichen? Was zeichnet die Schweden aus? Und war ihr Weg wirklich so viel besser? Wer mit Tegnell spricht, merkt eines schnell: Pragmatik und Ruhe kommen weit vor Polemik und Corona-Maßnahmen-Skepsis.
Falter: Herr Tegnell, was löst das Wort "Ischgl" in Ihnen aus?
Anders Tegnell: Ischgl wurde berühmt, nachdem viele Menschen mit einer Covid-19-Infektion zurückkamen, auch in nordische Länder. Damals gingen Bilder aus den Bars um die Welt. Ich erinnere mich an Besucher, die dieselbe Trillerpfeife im Mund hatten. Das erklärt, warum sich die Krankheit so leicht auf so viele Menschen ausbreiten konnte.
Hatten Sie damals mit österreichischen Politikern Kontakt -etwa dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)?
Tegnell: Nein, das lief alles über die zuständige Stelle, das European Centre for Disease Prevention and Control. Wir hatten ein Treffen mit unseren nordischen Nachbarn, die ebenfalls infizierte Heimkehrer registrierten. Aus Österreich hatten wir da noch nichts darüber gehört. Also teilten wir den Gesundheitsbehörden unsere Beobachtungen mit -die ihrerseits die Kontaktstellen in Österreich kontaktierten.
Österreich und Schweden könnten in ihrem Umgang nicht unterschiedlicher sein: Österreich entschied sich für sehr restriktive, staatliche Maßnahmen. Schweden hingegen verließ sich auf "Eigenverantwortung". Was waren die größten Fehler des jeweiligen Weges?
Tegnell: Ich spreche nicht gerne über die Fehler anderer Länder. Ich denke, jedes Land muss seine eigene Pandemie-Politik verantworten. Aber ich denke darüber nach, was wir hätten besser machen können -und da gibt es viel. Wir hatten große Probleme, schnell Ausrüstung zu beschaffen. Wir hatten Altersheime, die auf diesen Notfall sehr schlecht vorbereitet waren. Viele Menschen infizierten sich und starben. Und wir hatten auch keinen guten Kontakt zu Menschen, die aus Ländern außerhalb der EU eingereist sind. Wir konnten sie nicht rechtzeitig kontaktieren, um sie zu informieren, wie sie sich schützen sollen.
Insbesondere bei älteren Menschen und vor allem während der ersten Welle im Frühjahr 2020 war die Übersterblichkeit in Schweden sehr hoch. Ihre Kritiker werfen Ihnen das als schweres Versagen vor.
Tegnell: Das Sterben war nicht unserer Corona-Strategie geschuldet. Es war eine gesellschaftliche Schwachstelle: Die Altersheime hätten bessere Krisenpläne haben müssen, Leute besser schulen, bessere Ausrüstung haben müssen. Deshalb konnten sie die Menschen dort nicht ausreichend schützen. Sie haben es wirklich versucht.
War das aus Ihrer Sicht die Hauptursache für die hohe Sterberate?
Tegnell: Ja, es lag daran, dass diese Menschen die Verletzlichsten in unserer Gesellschaft waren. In diesen Altersheimen beträgt die Lebenserwartung auch ohne Covid-Infektion nur etwa sechs Monate. Ich erwähne das, um zu zeigen, wie alt und gebrechlich die Menschen dort sind.
Würden Sie mit dem Wissen von heute anders handeln?
Tegnell: Natürlich hätten wir in der ersten Welle besser handeln können. Aber die Zahl der Todesopfer in Schweden war nicht viel höher als in Spanien, Italien, Großbritannien und an vielen anderen Orten, die sehr strikte Maßnahmen verhängten. Die großen Ausnahmen waren die nordischen Länder - etwa Finnland und Norwegen.
Warum waren diese besser?
Tegnell: Wir müssen Norwegen und Finnland, vor allem Dänemark, als Ausnahmen in Europa betrachten. Die Pandemie, insbesondere während der ersten Welle, schlug dort ganz anders auf als in jedem anderen Land Europas. Dafür gibt es viele Gründe: Sie haben gute Gesundheitssysteme, sind aber auch nicht sehr dicht besiedelt. Es leben dort auch nicht so viele Menschen aus anderen Ländern.
Hat es denn überhaupt Sinn, Länder zu vergleichen? Covid-19-Todesfälle werden von Land zu Land unterschiedlich erfasst.
Tegnell: Nein, weil ich denke, dass die Kontexte -wie Sie angedeutet haben -in verschiedenen Ländern unterschiedlich sind.
Kommen wir noch einmal auf Schweden zurück: Warum haben sich die Leute dort freiwillig an Restriktionen gehalten?
Tegnell: Weil in Schweden großes Vertrauen in die Behörden und in die Politik herrscht.
Was ist der Grund dafür? Wir leben in Österreich, einem Land, in dem die rechtsgerichtete Partei FPÖ die Wahl gewinnt, weil die Menschen das Vertrauen in die Behörden, das Justizsystem, das medizinische System und in die Medien verlieren.
Tegnell: Ich kann Österreich nicht beurteilen. Aber ich kann sagen, dass es sehr lange dauert, gutes Vertrauen in Institutionen aufzubauen. In Schweden dauerte es wahrscheinlich mehrere hundert Jahre. Es gab und gibt hier ein Vertrauen in staatliche Autoritäten, weil sie einem wirklich das Gefühl vermitteln, dass sie für die Bürger Gutes tun.
In Ihrem Buch schreiben Sie über Ihre Tochter, die während der Pandemie auf La Réunion lebte und dort Partys feierte, obwohl es verboten war. Es ist also nicht die schwedische Herkunft, die dieses Vertrauen in Autoritäten stärkt, sondern die Autorität selbst.
Tegnell: Das ist definitiv meine Meinung. Wir Schweden sind nicht anders als Österreicher oder Franzosen. Aber unser Staat funktioniert anders. Er ist transparenter, die Menschen vertrauen ihm.
Viele Wissenschaftler vertrauen Ihnen nicht mehr. Sie sagen, Sie hätten das Leben der Schweden riskiert.
Tegnell: Viele Vorwürfe haben auch damit zu tun, dass Kritiker unsere Strategie bis heute nicht wirklich verstehen. Sie haben nicht das ganze Bild, weil wir es nicht vermitteln konnten. Wenn ich mit Kollegen in verschiedenen Ländern diskutiere, sind die Leute meistens sehr daran interessiert, wie wir es geschafft haben, die Dinge in Schweden ohne große Verbotspolitik zum Laufen zu bringen. Das ist das Überraschende: Letztlich haben wir dasselbe getan wie viele andere Länder. Wir haben versucht, die Menschen dazu zu bringen, weniger mit anderen Menschen zusammenzukommen. Wir haben es geschafft, dass sie es aus eigenem Antrieb tun, und nicht durch Zwang.
Wo fühlen Sie sich missverstanden?
Tegnell: Wir haben nie versucht, Herdenimmunität zu erreichen. Wir alle wissen, dass man diese nur erreichen kann, wenn man einen sehr guten Impfstoff hat, nicht indem man die Krankheit zulässt. Das würde allen schaden. Wir haben etwas anderes geschafft: eine freiwillige Verhaltensänderung.
Schwedische Medien zitieren immer wieder aus E-Mails, in denen Sie angeblich die Herdenimmunität anpeilten. Ist das falsch?
Tegnell: Ich habe in Mails über Herdenimmunität mit meinen Kollegen diskutiert. Wir haben darüber gesprochen, ob man mehr oder weniger Maßnahmen ergreifen muss. Herdenimmunität ist nur ein Indikator, der eine Vorstellung davon gibt, was wir tun müssen oder was wir nicht tun sollten.
Es gibt viele Covid-19-Leugner und Impfgegner, die Sie wie einen Helden verehren. Fühlen Sie sich missverstanden?
Tegnell: Es fühlt sich wirklich seltsam an, weil wir Covid-19 nie geleugnet haben. Wir waren uns der Gefahr äußerst bewusst und haben hart daran gearbeitet, die Verbreitung so weit wie möglich einzuschränken. Schweden ist extrem impffreundlich. Wir wussten: Es gibt keine schnelle Lösung für eine Pandemie. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Und wir waren der Meinung, dass es falsch war, der Bevölkerung immer wieder neue Signale zu senden. So verlieren sie das Vertrauen.
Wieso standen Sie als Behördenleiter eigentlich so im Mittelpunkt?
Tegnell: Das weiß ich nicht. Ich habe den schwedischen Weg definitiv nicht allein entschieden. Wir waren 500 bis 600 Leute, die zusammenarbeiteten. Ich war zufällig am Anfang der Sprecher, und dann kamen im Laufe der Zeit weitere hinzu.
Einer der größten Streitpunkte war die Frage, ob die Schulen geschlossen werden sollten. Warum waren Sie von Anfang an so sicher, dass sie geöffnet bleiben sollten - zumindest für kleine Kinder?
Tegnell: Weil wir anhand der Daten aus China und Italien schnell sehen konnten, dass Kinder sehr selten erkrankten und nur wenige Covid-19-kranke Kinder in den Krankenhäusern waren. Die Schulen zu schließen, um die Kinder zu schützen, machte also keinen Sinn. Wir konnten aus den Daten auch erkennen, dass Kinder die Krankheit nicht sehr stark verbreiteten. Erwachsene steckten sich gegenseitig an. Wir wissen aber, dass die Schule für Kinder unglaublich wichtig ist. Bildung entscheidet über die Zukunft - gesundheitlich und ökonomisch. Man muss also sehr gute Gründe haben, Kindern die Schulbildung und den Kontakt zu anderen Kindern zu verweigern.
Der deutsche Virologe Christian Drosten empfahl der Politik zu Beginn Schulschließungen. Lag er falsch?
Tegnell: Ich glaube nicht, dass wir viel Zeit verbringen sollten, darüber nachzudenken, wer Unrecht oder wer Recht hat. Wir haben versucht, das Richtige für Schweden zu tun. Wir hatten alle hinter uns: die Lehrer, die Schulbehörden, Experten.
Heute wissen wir, dass viele Kinder und Jugendliche in dieser Zeit große psychische Schäden erlitten haben. Wie geht es den schwedischen Jugendlichen heute?
Tegnell: Die Zahlen zeigen, dass wir auch in Schweden ein Problem mit der psychischen Gesundheit von Kindern haben. Aber das war auch davor offensichtlich. Es hat sich während der Pandemie nicht geändert und ist auch nach der Pandemie noch da.
In Ihrem Buch kritisieren Sie auch die Schließung von Schulen in Ländern des globalen Südens.
Tegnell: In vielen Ländern des globalen Südens haben die Maßnahmen mehr Probleme verursacht als die Covid-19-Pandemie an sich. Die Schließung von Schulen und die Tatsache, dass Menschen nichts verdienen konnten, hatten dramatische Auswirkungen -zumal die meisten Menschen in diesen Ländern jung und gesund sind.
Reden wir über die Zukunft. Was müssen wir über die nächste Pandemie wissen?
Tegnell: Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass die nächste Pandemie anders sein wird als die letzte. Wir brauchen ein widerstandsfähigeres Gesundheitssystem mit einer besseren Lagerung verschiedener Güter. Wir brauchen Altersheime, die besser auf Gesundheitskrisen vorbereitet sind. Wir brauchen auch bessere Systeme, um Neuankömmlinge aus Ländern außerhalb Europas zu erreichen. Wir müssen aber auch verstehen, dass man bei der Bewältigung einer Pandemie flexibel sein muss. Man muss sich an immer neue Daten anpassen und nicht versuchen, dasselbe zu tun wie beim letzten Mal.
Viele Menschen, die Covid-19 hatten, leiden jetzt an Long Covid oder ME/CFS. Wie groß ist das Bewusstsein hierfür unter Ihren Kollegen und Kolleginnen?
Tegnell: Diese schweren Erkrankungen sind eines der Probleme, die uns die Pandemie hinterlassen hat und die wir sehr ernst nehmen müssen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft unternimmt sehr viel, um Lösungen zu finden. Aber es hat sich als sehr schwierig erwiesen, den Leuten bei ihrem Leiden zu helfen. Wir brauchen mehr Forschung -überall auf der Welt.
In Österreich glauben viele Leute, hinter Corona stünde eine "Plandemie", eine Corona-Diktatur. Auch Ferdinand Wegscheider, der (ehemalige) Chefredakteur von ServusTV und der Kopf hinter dem Verlag, der die deutsche Ausgabe Ihres Buches lizensierte, schürte Anti-Impf-Propaganda. Wie können wir diese Menschen zurückholen?
Tegnell: Das ist die Millionen-Dollar-Frage und sie beunruhigt all unsere Gesellschaften. Auch in Schweden gibt es Impfskeptiker, aber nur wenige. Es hat keinen Sinn, zu versuchen, sie zu überzeugen. Worauf Sie sich konzentrieren müssen, sind die Menschen, die sich noch nicht sicher sind, ob Impfungen schaden. Dort müssen wir uns anstrengen und informieren.