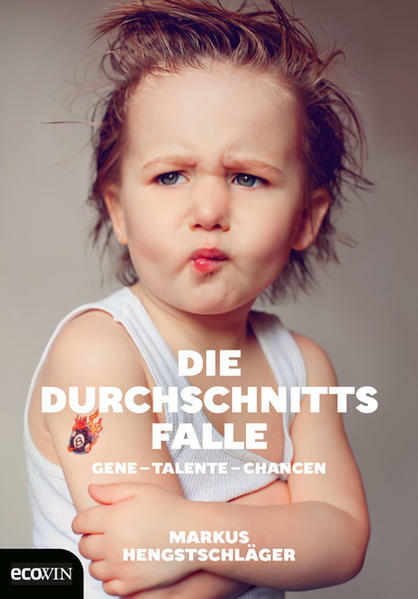Das Dilemma der Durchschnittsfalle
Sibylle Hamann in FALTER 6/2012 vom 08.02.2012 (S. 15)
Markus Hengstschläger macht aus einem einzigen Gedanken einen Bestseller. Eine Leistung, für die man ein ganz spezielles Talent braucht
Oja, Markus Hengstschläger hat einen interessanten Gedanken formuliert. Angenommen, Ihr Kind kommt mit einem Einser und mehreren Vierern im Zeugnis aus der Schule nach Hause. Worüber werden Sie – und die Lehrer, die Lehrerinnen – mit dem Kind reden, und womit wird es sich in den kommenden Monaten beschäftigen müssen? Wahrscheinlich nicht mit jenem Fach, in dem es besonders gut ist ("da reicht es eh"), sondern mit seinen Schwächen.
Ein dramatischer, folgenreicher Fehler, wie Hengstschläger meint. Ein Fehler, der uns dran hindert, das in unserer Gesellschaft schlummernde Talent zu entdecken, zu fördern und bestmöglich auszuschöpfen.
Mit diesem Gedanken hat Hengstschläger sicher Recht. Es ist großartig, dass der Genetiker und rührige Bestsellerautor ihn in die verfahrene Bildungsdebatte eingeworfen hat, und wir dürfen ihm dankbar sein, dass er diesen Gedanken mit schier unermüdlicher Verve in zahllosen Interviews und Vorträgen bis in die hintersten Winkel unseres Landes trägt.
Ein ganzes Buch hätte er daraus allerdings nicht unbedingt machen müssen.
Es kommt selten vor, dass man den kompletten Inhalt eines 185-Seiten-Buchs in einer Falter-Rezension unterbringen kann. Aber in diesem Fall ist das problemlos möglich, also tun wir's gleich einmal. Erstens: Was ein Mensch leisten kann, hängt sowohl von seinen genetischen Anlagen als auch von Umwelteinflüssen ab. Zweitens: Jeder Mensch ist anders, und das ist gut so. Drittens: Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Viertens: Wir sind für die Zukunft umso besser gerüstet, je verschiedener wir sind; wir sollten daher Individualität eher fördern als Gleichförmigkeit.
Ressourcenverschwendung
"So – damit habe ich das Wichtigste bereits gesagt und das wäre es auch schon wieder", schreibt der Autor auf Seite 23. Aber dann kommen halt noch 160 Seiten, gefüllt mit Sätzen wie: "Ich habe das an dieser Stelle beschrieben, um noch einen zusätzlichen Punkt anzusprechen, den ich im vorigen Kapitel schon angedeutet habe." "Einen wichtigen Aspekt möchte ich hier das erste, aber sicher nicht das letzte Mal aufgreifen." "Ich verwende dieses Beispiel immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen." "Ich weiß, wir haben das alles schon detailliert besprochen." "Wir haben diese Diskussion bereits geführt." "Es gäbe zu all dem noch so viel zu sagen." Aber leider: "Mehr als das soll und will ja auch niemand sagen."
Habe ich schon erwähnt, dass wir nicht wissen, was die Zukunft bringen wird? Ja, das haben Sie, möchte man dem Autor zurufen. Aber der Autor steht weit weg, oben auf der Kanzel, berauscht von seinem Esprit und dem verführerischen Klang seiner eigenen Stimme, und hört leider nicht zu.
Dabei gäbe es zu "all dem" tatsächlich noch so viel zu sagen. Etwa wenn wir Hengstschlägers Argumente mit der Migrations- und Integrationsdebatte verknüpfen.
Könnten die Zukunftsfragen besser gelöst werden, wenn wir aus möglichst vielen verschiedenen Individualitäten schöpfen – ist es da nicht völlig kontraproduktiv, auf die spezifisch anderen Erfahrungen von "Fremden" zu verzichten und ihre Anpassung an all das zu verlangen, was wir ohnehin schon wissen und kennen? Hengstschläger erwähnt das Wort "Migration" einmal, lässt es aber dann einsam im Gestrüpp der vielen anderen redundanten Wörter verhungern.
Wichtig ist etwa sein Hinweis auf das Reservoir brachliegenden Talents, das in Kindern aus bildungsfernen Schichten schlummert. Ja, das ist tatsächlich eine riesige "Ressourcenverschwendung", und es wäre dem Land sehr geholfen, würde die Bildungspolitik da mehr auf Hengstschläger als auf die Gymnasiallehrergewerkschaft hören.
Karriere mit Bravheit
Wichtig auch seine Warnung, dass übermäßiger Druck keineswegs zwangsläufig die Leistung verbessert – sondern auch Stress erzeugen, krank machen und Leistung ersticken kann. Oder der Hinweis, dass Innovation nicht von jenen zu erwarten ist, die zum Bravsein gezwungen werden, sondern eher von jenen, die oft als verhaltensauffällige Freaks in die Ecke gestellt werden.
Wer solche Gedanken zu Ende denkt, könnte sich jedoch sehr schnell Feinde machen. Zum Beispiel bei überehrgeizigen Kampfeltern. Bei wichtigen Leuten, die ihre Karriere ausschließlich ihrer Bravheit verdanken. Bei all jenen angepassten Menschen, die sich selbst gern "Elite", "A-Schicht" und "Leistungsträger" nennen. Bei der ÖVP.
Doch all die lieben Hengstschläger wohl am meisten. Und so unkonventionell sich der gern gibt (im Klappentext heißt es, er sei "mit 16 ein Punk" gewesen) – so richtig verscherzen will sich's der Autor anscheinend mit niemandem. "Es geht also nicht um eine "Entweder-oder"-Frage, sondern es ist uneingeschränkt und immer eine "Sowohl-als-auch"-Angelegenheit.
Nach vielen derartigen Sätze beschleicht einen schließlich das nagende Gefühl, sogar in Hengstschlägers so wunderbar einleuchtendem Anfangsgedanken könnte der Wurm stecken. Dass es mehr bringt, einen Menschen bei seinen Spitzenbegabungen zu fördern, und es okay ist, dafür jene Bereiche, in denen er bestenfalls durchschnittlich begabt ist, einfach links liegen zu lassen, klingt logisch. Aber stimmt es überhaupt?
Der Autor selbst, samt seiner Erfolgsgeschichte, könnte einen da durchaus ins Zweifeln bringen. Denn Hengstschläger macht ja nicht bloß, was er spitzenmäßig kann – Genetik, Medizin und Vorträge.
Er macht auch etwas, das er nicht so gut kann – schreiben. Und ist damit dennoch sensationell erfolgreich. Wenn das kein schlagender Beweis gegen seine eigene These ist!