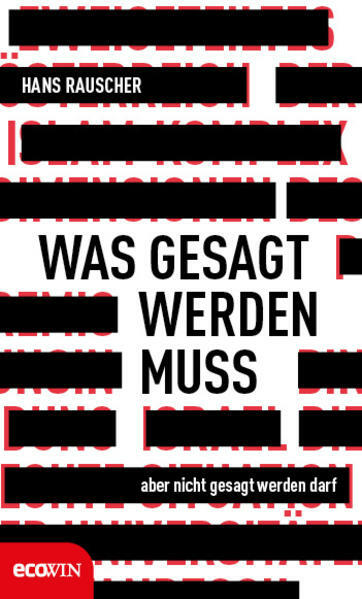„Ich habe versucht, die FPÖ-Wähler zu verstehen“
Florian Klenk in FALTER 16/2017 vom 19.04.2017 (S. 24)
Er ist einer der wichtigsten Kolumnisten Wiens und er vermisst die Auseinandersetzung mit den heiklen Themen der Populisten. Ein Gespräch mit Hans Rauscher über Tabus im Journalismus
Hans Rauscher hat ein Buch geschrieben. Das Buchcover ist geschwärzt. Darauf steht: „Was man nicht sagen darf“. Hat man ihm den Mund verboten? Ein Gespräch über Themen, die Journalisten ungern antasten.
Falter: Herr Rauscher, der Milliardär Dietrich Mateschitz beklagte kürzlich, wir würden in einem Meinungsdiktat leben. Und jetzt legen Sie ein Buch mit dem Titel „Was nicht gesagt werden darf“ vor. Wer hindert Sie daran, etwas zu sagen?
Hans Rauscher: Niemand. Wir leben in einem Land, wo die Meinung der liberalen Restbestände dieses Landes als Meinungsdiktat ausgegeben wird. In Wirklichkeit gibt es die rechtspopulistischen Zeitungen mit einem flächendeckenden Fast-Monopol. Und natürlich die sozialen Medien, wo die Rechtsdemagogie sehr stark ist. Und es gibt ein paar Widerstandsnester – Standard, Kurier, Kleine Zeitung, Profil, Falter, Teile des ORF, der Presse.
Sie schreiben: „Vielleicht haben die Wähler der Rechtspopulisten doch recht“.
Rauscher: Ich habe versucht, die FPÖ-Wähler zu verstehen, das kann man auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber dort, wo der Rechtspopulist dann ins total Autoritäre, Fremdenfeindliche und Irrationale abbiegt, muss der liberale Journalist anderswo abbiegen. Aber bis dahin muss man versuchen, dieser ungeheuren Missstimmung, dieser Wut auf den Grund zu kommen.
Ein Grund, so schreiben Sie, sei die Angst der Leute, die Zukunft zu verlieren.
Rauscher: Richtig. Sie fürchten sich davor, dass ihnen die Flüchtlinge die Sozialleistungen wegnehmen. Sie fürchten sich vor der großen Krise. Und ja, es gab eine Stagnation der Reallöhne, aber es geht schon wieder aufwärts. Es gibt mehr Arbeitslose, aber dafür gibt es aber einen unglaublich ausgebauten Sozialstaat.
Sie schreiben gleichzeitig, es gebe eine Grenze der Zuwanderung, die offenbar erreicht sei und über die liberale Journalisten und moderate Politiker nicht zu reden wagen.
Rauscher: Das ist für mich spürbar. Die Leute wollen nicht mehr. Sie sehen immer mehr junge Männer aus dem Nahen Osten, Afghanistan und sagen: Jetzt ist Schluss. Jetzt ist eine Grenze erreicht. Die Leute meinen die muslimische Migration. Die Religion ist ja für uns schon fast Folklore, aber bei Muslimen ist sie identitätsstiftend. Ich war bei einer Diskussion im Volkstheater. Es wurde „Die Welle“ mit Schülern aufgeführt. Und da saßen an die 1000 14- bis 17-Jährige im Zuschauerraum und anschließend war brav Diskussion über Faschismus. Da stand ein 17-jähriges Mädchen auf und hat gesagt: Ich wähle jetzt den Strache, weil die Türkenbuben im Park sagen zu mir „Christenfut“. Daraufhin ist es losgegangen! Die Lehrer sind kasweiß im Gesicht geworden. Das war eine der aufgeregtesten Diskussionen, die ich je erlebt habe.
Wie kann Journalismus mit solchen Themen umgehen?
Rauscher: Zunächst einmal soll er sie zur Kenntnis nehmen und beschreiben.
Findet das in Österreich ausreichend statt?
Rauscher: Nur in den Krawallmedien, die diese Themen als Kriminalberichterstattung bringen. Vor zehn Jahren habe ich mir gedacht, ich sehe viele Zuwanderer auf der Straße und weiß nicht, wie sie leben. Ich habe dann eine Serie gemacht.
Was ist dabei herausgekommen?
Rauscher: Wir hatten ein tolles Interview mit jungen Frauen vom Verein Orient Express, die sich um Zwangsverheiratete kümmern. Eine Gemeinderätin mit türkischem Hintergrund erzählte mir, in Wien seien 80 Prozent aller Ehen von Türken arrangiert. Und dann hatten wir lehrreiche Begegnungen mit den Imamen, die als Erstes die Stelle im Koran aufschlagen, aus der hervorgeht, dass der Islam so friedlich ist. Da haben sie schon das Lesezeichen drinnen. Was will ich damit sagen? Zuerst einmal müssen wir uns realistisch mit neuen Tatsachen auseinandersetzen, sie recherchieren. Still, geduldig, nachhaltig und uns keine Schmähs erzählen lassen. Dann muss man intervenieren, viel Geld in die Hand nehmen. Man muss Sozialarbeiter einsetzen. Man muss die Lehrer entlasten. Man muss die Väter und die Mütter zur Rede stellen. Die Väter, die noch immer den Lehrerinnen nicht die Hand geben, teilweise. Man muss die Normen der modernen Gesellschaft verdeutlichen.
Kommen wir zu der Geschichte vom Mädchen im Theater zurück. Woran liegt es, dass wir die Geschichte ihres Parks in Qualitätsblättern kaum lesen? Interessiert uns das nicht?
Rauscher: Es ist natürlich einfacher, über spalterische Tendenzen bei den Grünen zu schreiben. Es ist eine Ressourcenfrage, es ist aber auch eine Überwindungsfrage.
Viele Kollegen haben Angst vor dem Shitstorm. Der Reporter Thomas Rottenberg hat eine Geschichte über die U6 geschrieben, nachher wurde er auf Twitter tagelang betoniert, weil er es wagte, die alltägliche Gewalt zu beschreiben.
Rauscher: Wenn du so etwas machst, musst du dich darauf gefasst machen, dass du in den sozialen Medien hergewatscht wirst, dass es nur so kracht. Das ist ein Problem.
Sie werden sicher auch bald hergewatscht. Sie sprechen vom Problem, dass lauter junge, kräftige Männer einwandern.
Rauscher: Die Sozialwissenschaft sagt: Ein Überschuss an jungen Männern ohne Perspektive ist gleich Gewalt. Ich wohne im achten Bezirk, unweit davon ist ein Caritas-Heim, da kommen mir immer Afghanen entgegen. Harmlose, nette Männer. Und ich denke mir: Was sollen wir mit euch machen? Die Hälfte hat keine Ausbildung, die Analphabetenrate ist extrem hoch. Schon unter den besten Umständen hätten sie hier nur geringe Chancen.
Wenn Politiker diese Fragen aufwerfen, die Sie gerade stellen, werden sie in Qualitätsblättern gehaut, und zwar nach Strich und Faden.
Rauscher: Weil der Politiker, der sich diesem Thema widmet, es meistens mit einer bösen Absicht verbindet und nicht mit einer Lösungsabsicht. Sebastian Kurz hat ein gutes Problembewusstsein, aber seine Lösungsvorschläge sind oft undurchführbar und bisweilen unmenschlich, etwa das Internieren auf irgendwelchen Inseln. Und genau genommen ist ihm das Thema eigentlich auch wurscht. Also wir hauen die Politiker, die sich so äußern, mit einer gewissen Berechtigung, weil sie nicht in die Lösung hineingehen. Mit wenigen Ausnahmen.
Sie sind seit 50 Jahren Journalist, worüber „durfte“ man denn in Ihren Jugendjahren nicht schreiben?
Rauscher: Ich habe als Wirtschaftsjournalist begonnen, beim Österreichischen Volkswirt, und da herrschte bei uns ein reiner Verlautbarungsjournalismus. Journalisten wurden gerne beschenkt. Zu Weihnachten hast du die Tür in der Wirtschaftsredaktion des Kurier nicht zugebracht, weil da sind dir die Ski entgegengepoltert!
Der Journalismus war damals strukturell korrupt.
Rauscher: Der Wirtschaftsjournalismus war strukturell machtnahe. Und gegen diese Zustände hat Oscar Bronner mit seinem Chefredakteur Jens Tschebull 1969 den Trend gegründet, ich war in der Gründungsmannschaft. Tschebull hat von uns verlangt, dass wir laut sagen: „Wir nehmen nichts, wir sind vom Trend!“ Für den Satz haben wir uns zwar geniert, aber die Zustände waren wirklich aberwitzig: Du bist zur Verbundgesellschaft gegangen und hast nach der Pressekonferenz eine Bleikristallvase gekriegt.
Welche Geschichten hatten Sie damals geschrieben?
Rauscher: Eine meiner ersten Geschichten war über die Schoellerbank, die ziemlich viel Geld von Kunden verspielt hatte. Die Schoellerbank! Das war das Wiener Großbürgertum mit Goldrand, unantastbar! Solche Trend-Geschichten führten dazu, dass der damalige Präsident der Wiener Handelskammer die Parole ausgegeben hat, der Trend ist ein Kommunistenblatt, also darf man nicht inserieren. Bronner, der Nerven wie Drahtseile hatte, bekam aber einen Zwischenkredit, mit dem wir gleichzeitig auch das Profil gegründet haben. Dort haben wir die Geschäfte der Stadt Wien thematisiert. Den Kredit gewährte übrigens Josef Taus, der damals Chef der Girokredit war.
... der spätere ÖVP-Chef und Herausforderer Kreiskys, hat das „Kommunistenblattl“ Trend gefördert?
Rauscher: Er hat ihm eine Chance gegeben.
Worüber konnte man eigentlich mit Kreisky nicht reden?
Rauscher: Über sein Nazi-Beschützertum. Seine absolute Mehrheit hat er ja anfangs nur bekommen, weil er die Hand zur Versöhnung mit jenen ausgestreckt hatte, die, wie es damals bei ihm hieß, „geirrt haben“. Ohne den Pakt mit dem damaligen FPÖ-Chef Friedrich Peter wäre seine Minderheitsregierung unmöglich gewesen. Als Simon Wiesenthal die Mitgliedschaft Peters in der Waffen-SS aufgedeckt hat, ist die Kronen Zeitung Amok gelaufen und der Kreisky ebenfalls. Dieses ungeheuerliche Faktum, dass wir da einen im Nationalrat haben, der mit großer Wahrscheinlichkeit Menschen ermordet hat, darüber konnte man außer im Profil und ein bisserl im Kurier nicht mit der notwendigen Härte reden.
Warum haben die Österreicher eigentlich so eine andere Presselandschaft als die Deutschen?
Rauscher: Die wirtschaftlich erfolgreiche Mittelschicht, die sich für das Zeitungswesen interessierte, war nicht so groß, wurde auch im Nationalsozialismus ermordet. Wir waren ein Land der Beamten und Arbeiter. Die Beamten waren meist sehr konservativ und haben die Presse gelesen.
Aber auch die Journalisten arbeiten in Deutschland anders. Viele sind neugieriger, gehen anders vorbereitet in Pressekonferenzen, sind ernsthafter. Warum schaffen wir das nicht?
Rauscher: Das ist der Nationalcharakter. Uns fehlt zum Teil das Rechthaberische, das die Deutschen haben. Und wir sind groteskerweise wesentlich autoritätsgläubiger als die Deutschen.
Sie waren in den 80ern und 90ern in der Chefredaktion des Kurier. Gab es dort Dinge, über die man nicht schreiben durfte?
Rauscher: Ich habe einmal über Problemjäger geschrieben. Ein Kasterl nur. Da habe ich ein Murren aus der Hollandstraße (dem Sitz von Raiffeisen-General Christian Konrad, Anm.) vernehmen müssen.
Wie kommt so ein Murren daher? Ruft das Murren an?
Rauscher: Ja, das Murren ruft an.
Das Murren ruft an und sagt was?
Rauscher: „Was verstehstn du von der Jagd?“ Habe ich gesagt: „Na ja, ein Jäger hat einen Bären erschossen.“ Hat das Murren gesagt: „Hast eh recht, aber der ist ja gar kein richtiger Jäger.“ Und jetzt möchte ich noch was Wichtiges sagen: Der Kurier war in der Causa Waldheim mutig, so mutig möchte ich nie wieder sein müssen. Da habe ich noch Leserbriefe zu Hause – frage nicht. Zum Teil mit vollem Namen und voller antisemitischer Ausfälle. Aber der Herausgeber und die Eigentümervertreter haben gehalten.
Hasspostings in analoger Form.
Rauscher: Hassposter mit Professorentitel. Aber da muss man durch, gerade auch heute. Ich betrachte mich als Mitglied der Zivilgesellschaft, die in einem Land mit starkem autoritärem Denken versucht, dafür zu sorgen, dass dieses autoritäre Denken nicht die Oberhand gewinnt. Der Standard ist da für mich von unschätzbarem Wert, denn über unseren Online-Auftritt kommen wir über die liberale Kernklientel hinaus in Schichten hinein, die wir sonst nicht erreichen würden. Und das ist ein Vorzug des Standard, den man unbedingt ausbauen muss und den andere nicht haben.
Armin Wolf sagt, wir müssen die Social Media mit Journalismus fluten. Der Standard schenkt alles her. Wie lange kann das gut gehen?
Rauscher: Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht für Artikel im Netz zahlen müssen, mir ist das zu mühsam. Wir versuchen, die Einkünfte auf andere Weise zu generieren.
Etwa indem der Standard durch seine User-Foren massive Zugriffe generiert. Lesen Sie alle Postings?
Rauscher: Ich habe früher auch gesagt, warum muss ich mich mit den Verhaltensauffälligen herstellen. Und natürlich, den Ruaß muss man ausputzen, aber ich glaube nicht, dass wir da was ändern werden. Inzwischen empfinde ich es als Korrektiv, auch als Möglichkeit, in die Denke von Leuten hineinzusteigen. Und ich poste ja oft zurück. Das wird geschätzt.