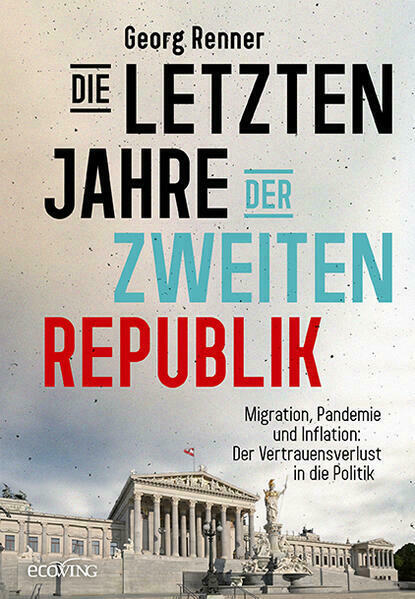Chronik eines durchaus turbulenten Jahrzehnts
Andreas Sator in FALTER 35/2024 vom 28.08.2024 (S. 20)
Der Journalist Georg Renner prüft den Effekt von Migrationskrise, Ibiza-Video und Ukraine-Krieg. Eine Lehre für 2024?
In Zeiten politischer Turbulenzen ist ein Blick zurück oft erhellend. Georg Renner, langjähriger Beobachter der österreichischen Innenpolitik, wagt in seinem Debütwerk "Die letzten Jahre der Zweiten Republik. Migration, Pandemie und Inflation: Der Vertrauensverlust in die Politik" genau das: eine Rückschau auf ein bewegtes Jahrzehnt österreichischer Politik.
Renner, zuletzt Leiter der Innenpolitikredaktion der Kleinen Zeitung und nun freier Journalist, liefert eine nüchterne Chronologie der Ereignisse: von der Migrationskrise, der verkorksten Bundespräsidentenwahl über das Ibiza-Video bis hin zum Ukraine-Krieg.
Das Buch beginnt mit dem Ende der letzten großen Koalition. Als es ÖVP und SPÖ gelang, inhaltliche Differenzen kontrolliert, ohne Schlammschlacht zu kommunizieren, nahm ihre Beliebtheit zu, schreibt Renner, der für seine abwägende Auseinandersetzung mit Politik bekannt ist. Die Migrationskrise und der Ehrgeiz von Sebastian Kurz erstickten die Chance auf Erneuerung unter Reinhold Mitterlehner und Christian Kern aber im Keim.
Gerade angesichts der aktuellen Diskussionen um eine etwaige Koalition von ÖVP, SPÖ und Neos nach der Wahl im Herbst ist diese Erkenntnis lehrreich.
Die Passagen, in denen Renner aus einzelnen Fäden einen größeren Zusammenhang webt, sind die Stärke des Buches. Etwa dass sich der österreichische Staat in den letzten zehn Jahren zuerst als zu schwach und dann als zu stark offenbarte: Migrationskrise und Pandemie legten die Schwächen eines föderalen Staates offen. Es mangelte an Plan und Personal. In der Pandemie zeigte der Staat seine andere Seite: Er blähte sich auf. Er griff zu erratischen Aktionen wie dem Schließen von Parks und überschüttete Firmen und Haushalte mit Steuergeld.
Das Buch ist klar strukturiert. Jedes Kapitel beginnt mit einer Auflistung von Stichworten, die dem Leser eine rasche Orientierung ermöglichen. Am Ende jedes Abschnitts teilt der Autor seine persönlichen Erkenntnisse aus der jeweiligen Periode mit. So plädiert er etwa dafür, weitreichende Eingriffe in persönliche Freiheiten wie die Impfpflicht künftig, wenn überhaupt, nur nach breiter öffentlicher Debatte zu beschließen.
Trotzdem bleibt das Buch bei einer Aneinanderreihung von Ereignissen stehen. Renner betont, er wolle seine eigene Meinung außen vor lassen. Das ist zwar nachvollziehbar, dem Buch aber hätte noch mehr Analyse gut getan. Genauso wie der Verweis auf Daten, Quellen oder Studien, wie man das von ihm sonst kennt. Der Untertitel des Buches suggeriert einen Vertrauensverlust in die Politik. Interessanterweise zeigen Eurobarometer-Daten jedoch, dass das Vertrauen in Regierung und Parlament derzeit ähnlich hoch bzw. niedrig ist wie im Durchschnitt der vergangenen 25 Jahre.
An wen richtet sich das Buch? Die Frage bleibt offen. Für politisch Interessierte bietet es kaum Neues, für Einsteiger hätte es zugänglicher geschrieben werden können. Journalisten werfe man oft vor, sie wollten selbst Politik machen, schreibt Renner. Er wünsche sich das nicht, denn es habe in all diesen Jahren keine Regierung gegeben, die einfach ihr Regierungsprogramm abarbeiten und Politik nach Plan hätte machen können. In der Dichte der Ereignisse wird bewusst, wie getrieben man als Politikerin und Politiker ist. Und bei all der berechtigten Kritik an ihnen bleibt nach der Lektüre dieses durchaus wertvollen Überblicks über ein turbulentes Jahrzehnt auch das zurück: die Einsicht, dass das alles nicht so einfach ist, wie die meisten denken.