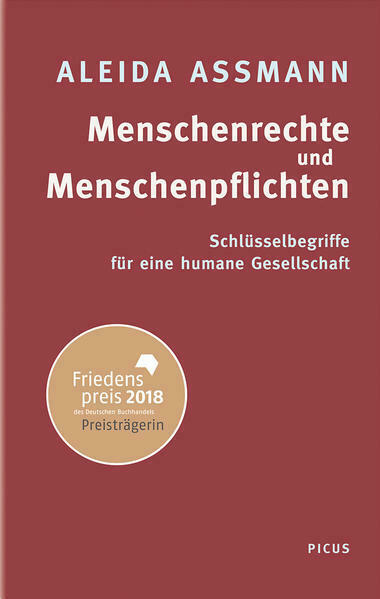„Es gibt auch Menschenpflichten“
Klaus Nüchtern in FALTER 43/2019 vom 23.10.2019 (S. 34)
Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann schlägt vor, Begriffe wie „Nation“ und „Heimat“ nicht zu verabschieden, sondern mit zeitgemäßen Inhalten zu füllen: „Wir brauchen etwas, wozu wir uns bekennen“
Aleida Assmann ist eine der bekanntesten und renommiertesten Wissenschaftlerinnen des deutschen Sprachraums. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Assmann, hat sie die Kulturwissenschaften in den letzten zwei Jahrzehnten durch die Ausarbeitung des Konzepts des kollektiven kulturellen Gedächtnisses maßgeblich beeinflusst. Nach Wien, wo sie 2005 die Peter-Ustinov-Gastprofessur innehatte, war Assmann vergangene Woche auf Einladung des Instituts für die Wissenschaft vom Menschen gekommen, um die nach dem tschechischen Philosophen und Menschenrechtsaktivisten Jan Patočka benannte Patočka Memorial Lecture zu halten.
Dass das Thema ihres Vortrags, „Die Wiedererfindung der Nation: Erinnerung, Identität, Emotionen“, so aktuell wie brisant ist, muss man nicht lange und umständlich erklären. Ob man nun nach Großbritannien, Italien, Polen oder Ungarn und nicht zuletzt aufs eigene Land blickt – überall ist zu beobachten, wie eine bornierte Re-Nationalisierung mit der Infragestellung von Minderheiten- und Menschenrechten einhergeht, liberale Freiheiten – durchaus mit Zustimmung des Volkes, also ganz demokratisch – demontiert und überwunden geglaubte Narrative wiederbelebt werden. Das berühmte Bonmot aus dem Roman „Requiem für eine Nonne“ (1951) des Literaturnobelpreisträgers William Faulkner behält seine mitunter gruselige Brisanz: „Das Vergangene ist niemals tot. Es ist nicht einmal vergangen.“
Falter: Frau Assmann, aus aktuellem Anlass, aber eigentlich ohnedies zum Thema Ihres Vortrags passend: Was sagen Sie zu den beiden Literaturnobelpreisen?
Aleida Assmann: Ich freue mich, dass Olga Tokarczuk gewürdigt wird. Wobei ein Preis ja nicht immer nur eine Würdigung ist, sondern auch eine Mahnung an das Land sein könnte, auf jene Autorinnen und Autoren stolz zu sein, deren Position die Regierung nicht teilt. Und Peter Handke ist tatsächlich ein Autor, der mich ein ganzes Leben lang begleitet. Er hat uns schon 1965 mit seiner „Publikumsbeschimpfung“ äußerst animiert und schon vor der Studentenrevolution diesen Sound, allerdings spielerisch-ästhetisch, umgewandelt. Völlig verschieden waren dann die sehr introvertierten Texte, die auch ganz andere Gefühlsdimensionen aufgetan haben. Ich bin ein großer Fan, weil ich den langsamen Duktus des Lesens ungemein schätze, den seine Bücher verlangen. Die Serbien-Geschichte finde ich sehr, sehr ärgerlich, und ich bin über diese Volte in Handkes Biografie auch sehr erschrocken. Aber so ist das eben bei Preisträgern: Wir können sie uns nicht so zurechtmachen, wie wir sie wollen.
Ist nicht die sogenannte
„Debatte“ über Handke auch ein
„Dialog unter Schwerhörigen“,
wie es mit dem schönen, von Ihnen
zitierten Ausspruch des französischen Historikers Marc Bloch heißt?
Assmann: Genau. Menschen, die sehr stark in einem Kollektiv verankert sind und sich abschotten, sind nicht in der Lage, Ambivalenzen auszuhalten. Man muss diesen Wir-Verbund also unbedingt so gestalten, dass er weniger wehrhaft nach außen ist und kritische Stimmen zulässt. Ich möchte die im Falle Handkes auch nicht zum Schweigen bringen. Dass zeitgleich der Deutsche Buchpreis an den Handke-Kritiker Saša Stanišić und dessen Buch „Herkunft“ gegangen ist, müssen wir verkraften, ohne eine dieser unterschiedlichen Perspektiven auszuschließen.
In Ihrem Vortrag geht es um die „Wiedererfindung der Nation“. Dass eine solche nötig oder überhaupt möglich wäre, ist aber nicht unumstritten?
Assmann: Im linken Spektrum war der Begriff der Nation tatsächlich weitgehend tabuisiert, was mit historischen Erfahrungen zu tun hat. Hinzu kommt, dass die Linke und die Modernisierungstheorie die Auffassung vertraten, dass Nationen ein Anachronismus seien, der sich von alleine auflöst. Die Linke behauptet, dass die Nationen wieder gewalttätig werden, und die Rechte sorgt dafür, dass das auch so ist. Die größere Gefahr geht aber von der Rechten aus, die sich den Begriff der Nation nimmt wie einen leeren Container, der von der Linken liegen gelassen wurde, und diesen mit Hass befüllt.
Es ist auch die Meinung weit verbreitet, dass der Nationalismus unvermeidlich zum Nationalsozialismus geführt hätte. Stimmt das überhaupt?
Assmann: Natürlich nicht! Das ist aber der Wind, der einem unter Intellektuellen entgegenweht. Im akademischen Diskurs gibt es Begriffe, die wie ein Absperrkegel im Straßenverkehr funktionieren: Hier geht’s nicht weiter. Und wer trotzdem weiterfährt, kriegt einen Strafzettel.
Was kann man dagegen tun?
Assmann: Wir müssen es schaffen, wieder zu einem positiven Begriff von Nation zurückzufinden, ohne uns dadurch in die rechte Ecke drängen zu lassen.
Das scheint besonders in Deutschland komplizierter zu sein als in anderen europäischen Ländern.
Assmann: Ja. Im Unterschied zu anderen Nationen, wo man zunächst einmal Engländer, Spanier, Lette oder was auch immer und danach Europäer ist, hadern die Deutschen aus historischen Gründen mit ihrer Identität. In der dritten oder vierten Generation nach dem Holocaust wird das aber nicht mehr verstanden: Die fragen sich dann schon, warum eine positive Identifikation mit der eigenen Nation nicht möglich sein soll.
Muss man den noch immer unterschätzten Aufstieg der AfD in diesem Zusammenhang als ein Stück Normalisierung verstehen? Anders gefragt: Kommt Deutschland
jetzt erst dort an, wo andere Nationen längst sind?
Assmann: Entschuldigung, aber da muss ich heftig widersprechen. Erstens würde ich nicht unterschreiben, dass die AfD unterschätzt wird. Zweitens kann keine Rede davon sein, dass hier eine Normalisierung stattfände. In der AfD gibt es zwei Positionen. Die eine wird von Björn Höcke vertreten, der ist ein Neo- oder Alt-Nazi, der das, was damals passiert ist, nicht bloß gutheißt, sondern rühmt und preist. Die andere Position besetzt Alexander Gauland. Der sehnt sich in seinem Buch nach einem lateinischen Mittelalter der Salier und Staufer zurück. Und dann gibt es das Kapitel über Hitler, das unter der Überschrift „Nihilistische Versuchung“ firmiert. Gauland findet das nicht gut, was Hitler wollte, aber der ist halt das einzige Unkraut in einem Beet an schönen Blumen, das man nur auszuzupfen braucht.
In dem ersten Gesetz, das die Zweite Republik verabschiedet hat, steht der schöne Satz, dass Österreich von Hitler in einen Krieg geführt wurde, den kein Österreicher jemals gewollt hat.
Assmann: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Genau diese Staatsdoktrin hat es Österreich erlaubt, sich mit dieser Materie lange Zeit nicht befassen zu müssen. Es gab ja bei euch auch kein 1968, wo die Kinder, die Eltern gefragt hätten, was die im Krieg eigentlich gemacht haben. In meinem Vortrag habe ich auch Leszek Kołakowski zitiert, der sagt: „Wir müssen aus der Geschichte lernen, um die Gesichter derjenigen zu erkennen, die am meisten unter ihr gelitten haben.“ Ich finde, das ist ein großartiger Satz, der genau erklärt, was ich unter dialogischer Erinnerungskultur verstehe.
Sie zitieren allerdings auch eine Rede Winston Churchills aus dem Jahr 1946, wo dieser davon spricht, dass das neue Europa auf „einen Akt des Vergessens aller Verbrechen und Irrtümer der Vergangenheit“ gegründet werden müsse.
Assmann: Man kann das Vergessen natürlich nicht verordnen, aber die athenische Polis konnte den Bürgerkrieg auch dadurch beenden, dass sie ein Gesetz verabschiedet hatte, das es untersagte, öffentlich an diese Dinge zu rühren. Schweigen kann also eine Form der Befriedung sein. In Ruanda ist der Völkermord von den Gacaca-Gerichten nach indigenem Recht drei Jahre lang intensiv verhandelt worden, danach wurde ebenfalls ein Schweigen verfügt. Die Formel, mit der man wieder neu beginnen kann, lautet „Vergessen und Amnestie“. Churchill wollte verhindern, dass sich wiederholt, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist: Aus dem hatte Deutschland sozusagen „negativ gelernt“ und auf diese Weise einen Kriegsmythos aufgebaut, der dann in den Zweiten Weltkrieg mündete.
Churchills Idee hat also nicht gegriffen?
Assmann: Nein. 40 Jahre lang hat man es mit dem Vergessen versucht, aber die Erinnerungen kamen zurück. Zunächst 1961 mit dem Eichmann-Prozess und schließlich in den 1980er-Jahren. Es geht hier um Traumata, also um Langzeitschäden der Psyche, wobei sich der Begriff des Traumas ja erst nach dem Vietnamkrieg etabliert hat. Wenn wir es mit asymmetrischen Gewaltbeziehungen zu tun haben – etwa im Falle eines Genozids, wo es um Mord an der Zivilbevölkerung geht – heilt Vergessen keine Wunden. Auch im Hinblick auf den Spanischen Bürgerkrieg hat man keinen Modus des Umgangs mit der Vergangenheit gefunden. Da gibt es nur den Sieg Francos, mit dessen Denkmälern das ganze Land überzogen ist, wohingegen die republikanische Seite in Massengräbern verscharrt bleibt. Auf diese Weise wird der Krieg gleichsam in Gang gehalten, weil es keinen Ausgleich und kein gemeinsames Narrativ gibt.
In Polen läuft gerade ein Prozess gegen den Direktor des Museums des Zweiten Weltkrieges, der das ursprüngliche Konzept revidiert hat. Glauben Sie, kann man das Versagen von Geschichtspolitik dadurch korrigieren, indem man das vor Gericht ausjudizieren lässt?
Assmann: Die Aufgabe der Justiz besteht darin, Täter zu verurteilen, aber nicht, in die Erinnerungskultur einzugreifen. Wenn ein Land zu keiner Einigung über seine unterschiedlichen Geschichtserfahrungen kommt, kann das auch durch Gerichtsbeschlüsse nicht gelöst werden, ganz im Gegenteil: Man radikalisiert dadurch nur die Gegner.
Aber worauf sollen sich Parteien, die einander im Bürgerkrieg bekämpft haben, einigen?
Assmann: In Spanien gab es 1977 nach dem Tod Francos einen Pakt des Schweigens, um den Übergang von der Diktatur zur Demokratie zu ermöglichen. Spätestens 2000 mit der großen Exhumierungskampagne, in der man die Großväter aus den Massengräbern holte, um sie pietätvoll zu bestatten, hätte man aber darüber reden müssen.
In den „Memory Studies“ und der Politikwissenschaft haben die Affekte zur Zeit Hochkonjunktur. Im politischen Diskurs werden sie aber immer der anderen Seite zugeschrieben: Gefühle mobilisieren immer die anderen.
Assmann: In der Erinnerungsforschung waren die nie weg, denn Erinnerung funktioniert überhaupt nicht ohne Affekte. Nur dort, wo es einen Affekt gibt, wird die Erinnerung stabilisiert. Die Erinnerungsforschung war allerdings bis in die 1980er- und 1990er-Jahre erstens rein individualistisch gedacht und der Psychologie angegliedert. Es ist unfassbar, dass die Historiker bis zur Jahrtausendwende gebraucht haben, um draufzukommen, dass Geschichte was mit Gefühlen zu tun hat! Auch die Modernisierungstheorie hat da immer wahnsinnig stark verkürzt, weil sie auf einem sehr amerikanischen Individualismus aufbaut. Der amerikanische Traum ist ja ein sehr egoistisches, auf Wettbewerb ausgerichtetes Modell, in dem Solidarität und Empathie wenig Platz haben.
Ist das nicht wiederum ein zu schlichtes
Bild der USA? Immerhin hat der republikanische Politiker Ben Sasse die Unite-the-White-Umzüge von Charlottesville als „unamerikanisch“ gebrandmarkt und von den USA als einer „Bekenntnisnation“ gesprochen.
Assmann: Da möchte ich sofort emphatisch zustimmen! Ich bin mit 16 ein Jahr lang in den USA in die Schule gegangen, und dort gab es jeden Vormittag Fahnenappell, bei dem man folgenden Eid sprach: „I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.“ Das ist ein Bekenntnis zu einer wahrhaft pluralen Einwanderungsgesellschaft. Ob die Realität dem immer entspricht, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls hatten wir in der Klasse einen rothaarigen Jungen, von dem ich nicht gewusst hätte, dass er Jude ist, wenn er nach dem „liberty and justice for all …“ nicht immer noch ein „… redheaded jews“ drangehängt hätte. Ich fand das wunderbar. Das hat mir klargemacht, dass wir mit unserem so aufgeklärt links daherkommenden deutschen Antinationalismus auf dem falschen Weg sind. Wir brauchen auch etwas, wozu wir uns bekennen.
Glauben Sie, dass die europäischen Staaten einen solchen kollektiven Enthusiasmus für die bislang nicht wahnsinnig gut gelaufene Integration nutzbar machen?
Assmann: Wir können meines Erachtens von den Nationen nicht absehen, weil diese als kulturelle Gebiete mit einer Geschichte einen Rahmen bereitstellen, in dem ich mich platzieren, an dem ich mitbauen kann und der so die Möglichkeit zur Identifikation schafft. Die EU ist dafür viel zu groß. Man muss sich zunächst einmal lokal verankern. Das gilt auch für die Neuankömmlinge, die den Schutz der Nation zu spüren bekommen sollen, denn andernfalls ist eine Verankerung und auch eine Investition in das Land gar nicht möglich. Außerdem wissen wir aus der langen Einwanderungsgeschichte, dass diejenigen, die integriert wurden, zu den wichtigsten Unterstützern bei der Integration nachfolgender Zuwanderer geworden sind.
In letzter Zeit ist eine ganze Flut von Büchern zum Thema „Heimat“ erschienen, viele davon auch mit der Argumentation, dass man den Begriff nicht den Rechten überlassen soll. Aber ist der Begriff nicht einfach verbrannt?
Assmann: Wenn man einen Begriff lange Zeit nicht gebraucht, trocknet er aus. Man muss ihn sich also wieder aneignen. Ad acta legen kann man ihn nicht, denn er kommt ja von allen Seiten zurück. Und so, wie man den Menschen nicht dauerhaft Gefühle absprechen kann, so kann man ihnen auch Heimat nicht dauerhaft absprechen. Das ist für mich eine anthropologische Universalie. Dass der Heimatbegriff neu gefasst werden muss, hängt natürlich mit den globalen Fluchtbewegungen zusammen.
Das Wort Heimat ist ja nie wirklich verschwunden, es wird von rechts massiv als Exklusionsbegriff verwendet. Sie haben in einem Ihrer letzten Bücher Hannah Arendt zitiert, die vom „Recht, Rechte zu haben“, spricht. Genau das wird heute massiv in Zweifel gezogen.
Assmann: Heimat ist aber kein Rechtsbegriff. Da kommen wir wieder auf die Nation zurück, denn die ist es, die Rechte einräumt und Staatsbürgerschaften vergibt. Der Heimatbegriff hilft uns vielleicht, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie ein neuer Rechtsraum belebt werden kann.
Wäre die als inkludierende verstandene Nation der organisatorische und rechtliche Rahmen dafür, dass Heimat als Bündel von Affekten gedeihen kann?
Assmann: Ich würde sagen, dass man Heimat neu denken kann und nicht immer als das verstehen muss, was einem in die Kindheit geschienen hat. Bei Ernst Bloch ist der Begriff ja sehr rückwärtsgewandt und nostalgisch. Ich frage mich, wie so ein neuer Heimatbegriff aussehen muss, und ein Kriterium ist, dass man nicht ständig gefragt wird, wo man herkommt.
Der Heimatbegriff der Rechten macht Rechte immer von „Herkunft“ abhängig, ein links gewendeter müsste sich auf die „Hinkunft“ beziehen: Was machen wir daraus? Dazu braucht’s aber nicht bloß ein historisches Narrativ, sondern eine lebendige kollektive Erfahrung.
Assmann: Absolut! Da geht es immer auch um die Frage, wie sich die Mehrheitsgesellschaft verändern muss, um die Dinge bereitzustellen, die nötig sind, damit sich Menschen in ihrer neuen Umgebung heimisch fühlen. Die Leute müssen auch ihreAnkunfts- und Herkunftsgeschichte erzählen können. Und das muss wiederum dokumentiert werden, zum Beispiel in Museen.
Menschen, die zuziehen, müssen immer einen Nachweis erbringen, dass sie über die richtigen Einstellungen und Werte verfügen. Eigentlich wird nicht Integration, sondern Assimilation verlangt. Viel seltener ist davon die Rede, was man ihnen eigentlich zu bieten hat.
Assmann: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Über die Menschenrechte gibt es ganze Bibliotheken, dabei ist das eine sehr westliche und relativ kurze Geschichte, die nicht hinter das 18. Jahrhundert zurückreicht. Es gibt aber auch eine Tradition der Menschenpflichten, über die es bislang so gut wie gar keine Literatur gab. Die ist 4000 Jahre alt und findet sich unter anderem in ägyptischen Gräbern. Dort werden auch die Wohltaten der Bestatteten dokumentiert, also, dass man den Durstigen zu trinken gegeben, den Nackten bekleidet, den Schiffbrüchigen aufgenommen hat und so weiter. Dieser Katalog hat dann Niederschlag gefunden in den sieben Werken der christlichen Barmherzigkeit. Und diese Kultur der Mitmenschlichkeit wird gar nicht von den Religionen okkupiert, sondern ist weltweit verbreitet und – im Unterschied zu den Menschenrechten – unabhängig voneinander an verschiedenen Orten entstanden.
Das ist auch eine anthropologische Konstante?
Assmann: Genau. Positiv gewendet: Was du willst, dass man dir tut, das tue du auch den anderen. Das sind Pflichten, die nicht vom Staat geregelt werden und nicht über ein Recht erstritten werden müssen. Damit Menschenrechte überhaupt funktionieren können, muss auf der horizontalen Ebene ein Sozialzusammenhang aufgebaut werden. Das ist das Miteinander in den Städten, wo im Zeitalter der globalen Migration zusammenwächst, was nicht zusammengehört – wie Ulrich Beck es einmal ausgedrückt hat. Das passiert derzeit überall, und da kann man sich an diese sehr alten Regeln halten, die in allen Kulturen unter dem Stichwort „Weisheit“ verbucht und tradiert werden.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: