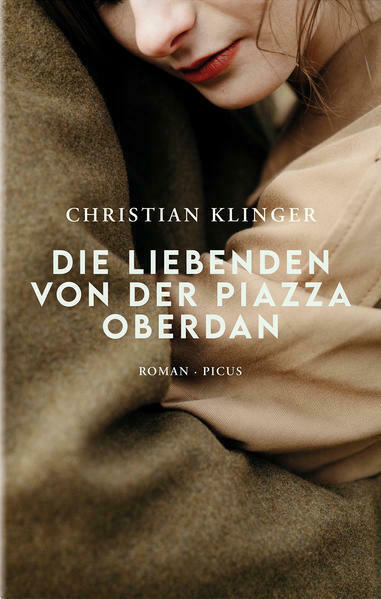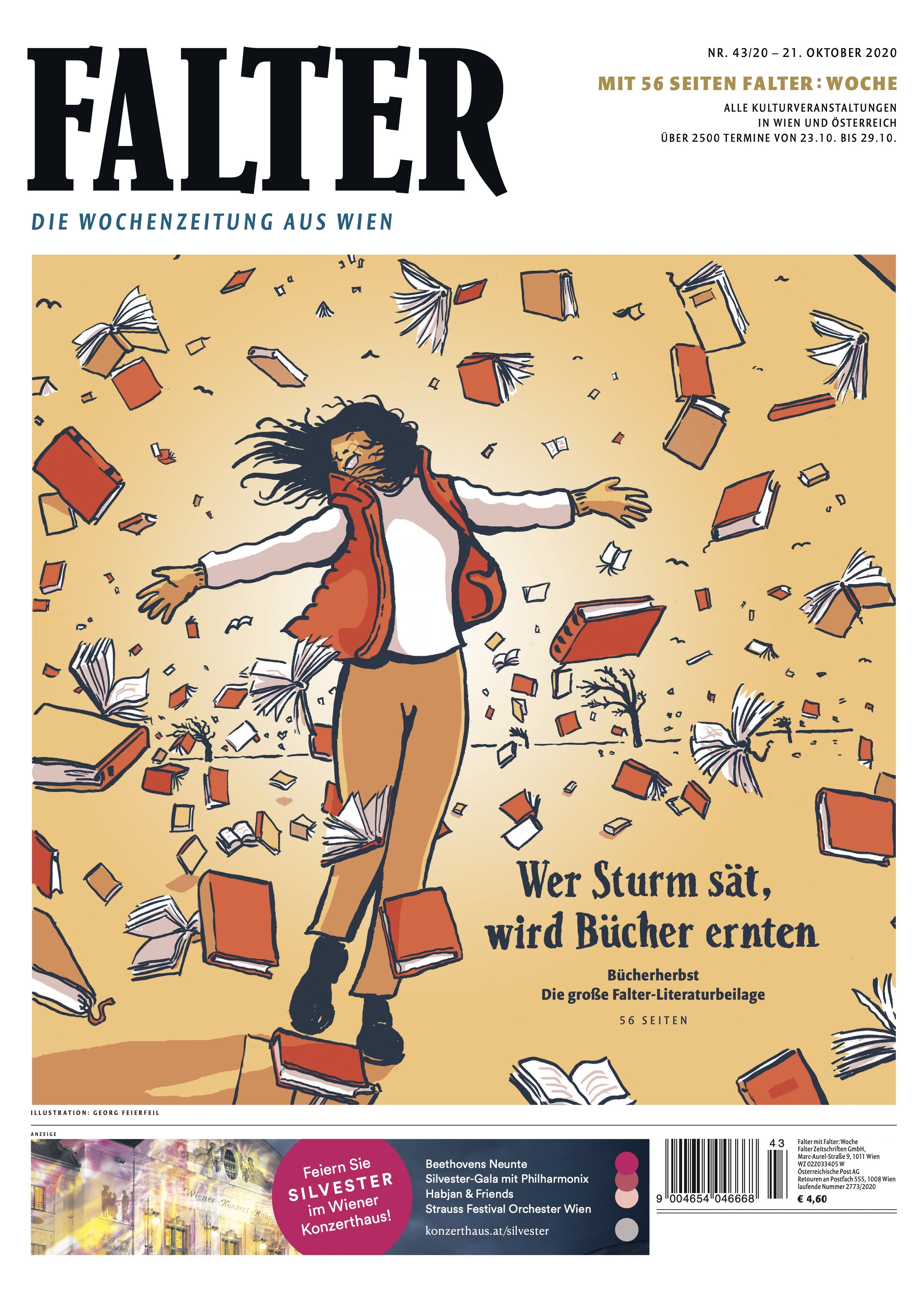
Es wachsen die Stilblüten und das Achselhaar
Sebastian Gilli in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 13)
Es gibt Bücher, die wecken sofort Erwartungen: Sie beginnen zum Beispiel am 6. April 1945, die Kapitulation Hitler-Deutschlands steht bevor. Der Ort der Handlung verspricht Spannung: Die Hafenstadt Triest ist ein Melting Pot der Kulturen und Religionen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so ziemlich alles durchgemacht hat – Ende der Habsburgermonarchie, Königreich Italien, Mussolinis Faschismus und Besetzung durch die Nazis.
Eben jene bereiten sich an diesem Tag auf ihren Rückzug vor, das heißt, sie erschießen ihre Gefangenen, vor allem die politischen Häftlinge. Unter ihnen ist Pino, der den klingenden Namen Robusti trägt, ein 22-jähriger Italiener, der angeblich mit den jugoslawischen Partisanen kollaboriert hat, aber auch unter SS-Folter nicht aussagt. Ob er sterben muss, wird sich erst am Schluss herausstellen, denn Pinos Vater Vittorio ist ein angesehener Anwalt, der beste Kontakte hat. Aber lange bevor das Finale von Christian Klingers kriegskitschigem Roman „Die Liebenden von der Piazza Oberdan“ erreicht ist, verpuffen alle anfangs gehegten Erwartungen in der Triestiner Meeresluft.
Dass diese historische Familiensaga missglückt ist, liegt an der überakzentuierten Kapitelkonstruktion, an inhaltlichen Ungereimtheiten (der sich um den italienischen Patriotismus drehende Vater-Sohn-Konflikt, die Charakterisierung Pinos als unpolitisch), aber vor allem an der seltsam simplen Sprache, in der der Autor, 1966 in Wien geboren, die von einer historisch verbürgten Begebenheit ausgehende Liebesgeschichte verfasst hat.
Die Blicke sind „lüstern“, die Nacht ist „verzweifelt“, das Schweigen „züchtig“. Aber trotz der zahlreich bemühten Herz-Metaphern („Lächeln im Herzen“) erreichen sie den Lesenden nicht. Das Bemühen, die Gefühle und Handlungen der Figuren möglichst realistisch darzustellen, bleibt fruchtlos, bringt das Gegenteil hervor: eine artifizielle Schreibe mit umständlichen Dialogen.
Phrasenhafte Formulierungen – „Es gab ihm einen Stich“, „Pino stand wie angewurzelt da“ – unterlaufen den Versuch, die innere Zerrissenheit der Figuren – sei’s in Liebesdingen, sei’s in ideologischen Konflikten – glaubhaft darzustellen. Besonders blumig ist Pinos Geburt geraten: „In diesem Augenblick entzündete sich in Vittorio ein Licht, das ihn mit unendlicher Wärme und Liebe durchströmte.“ Und als dieser in die Pubertät kommt, erfährt man: „Es wuchsen ihm Haare unter der Achsel und anderswo.“ Na geh