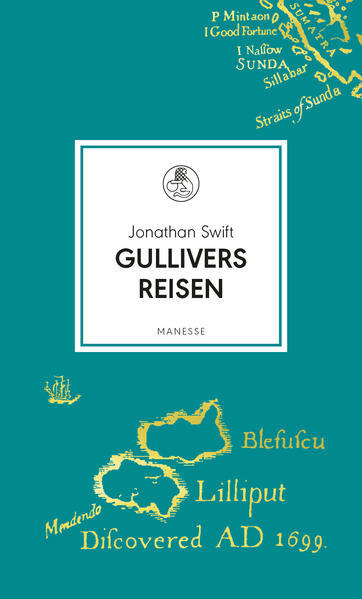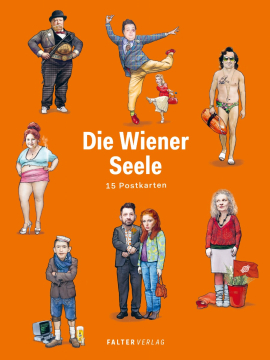In der Busenspalte einer Brobdingnagesin
Klaus Nüchtern in FALTER 48/2017 vom 29.11.2017 (S. 39)
In seiner Satire „Gullivers Reisen“ nahm Jonathan Swift den Darwinismus und den Postkolonialismus vorweg
Unter all den Inselbüchern, die auch als Kinder- und Jugendbuch Karriere gemacht haben – „Robinson Crusoe“, „Die Schatzinsel“ und „Gullivers Reisen“ – ist Letzteres fraglos das für diesen Einsatz am wenigsten geeignete. Bezeichnenderweise sind die beiden ersten Reisen, die den Ich-Erzähler mit Wesen konfrontieren, die zwölfmal kleiner bzw. zwölfmal größer sind als dieser selbst, die mit Abstand bekanntesten. Sie machen aber gerade einmal ein Viertel des 1726 im englischen Original – „Travels into Several Remote Nations of the World in Four Parts by Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and Then a Captain of Several Ships“ – erschienenen Romans aus. Es darf also vermutet werden, dass dieser zu jenen Werken der Weltliteratur zählt, die selten zu Ende gelesen werden.
Das ist weiter nicht schlimm, denn zum einen wird das Zuendelesen als sportliche Disziplin ohnehin überschätzt, zum anderen kommt die episodische Struktur von Jonathan Swifts Abenteuergeschichte der Kurzstreckenlektüre ja auch entgegen. Einer solchen soll hier zwar nicht das Wort geredet, es soll allerdings auch nicht verhehlt werden, dass die Ausflüge nach Laputa, Balnibarbi, Glubdubdrib, Luggnagg und Japan sowie die finale „Reise nach dem Lande der Houyhnhnms“ dem irischen Schriftsteller und Priester nicht ganz so kurzweilig und bildstark geglückt sind wie jene nach Lilliput und Brobdingnag.
Das hat vor allem damit zu tun, dass Swift die Schilderung abenteuerlicher und komischer Begebenheiten im zweiten Teil des Romans zugunsten des satirisch-philosophischen Exkurses über das England des beginnenden 18. Jahrhunderts zurückgenommen hat. Die soeben aus Anlass des 350. Geburtstags des Autors in neuer, auch haptisch herrlicher Ausstattung neu aufgelegte Ausgabe der Übersetzung von Christa Schuenke geht den Lesern mit einem informativen, aber nicht exzedierenden Fußnotenapparat an die Hand und weist diese etwa darauf hin, dass sich Swift in seiner Beschreibung der großen Akademie von Lagado weidlich über die 1662 gegründete Royal Society lustig gemacht hat. Unter anderem wird von einem Akademiemitglied berichtet, das jeden Besucher um Geld anschnorrt, um ein seit acht Jahren laufendes Forschungsprojekt zu finanzieren, welches darin besteht, „aus Gurken Sonnenstrahlen zu extrahieren“.
Im selben Kapitel liefert der Autor noch weitere brüllend komische Beiträge zum Genre „Da lacht der Universitätsdozent“. So verfolgt einer der Gelehrten das Vorhaben, mittels eines „äußerlich anzuwendenden Gemischs aus Harzen, Mineralien und Gemüse“ die Wollbildung bei Schafen zu unterbinden, und drei Professoren der Sprachfakultät sind übereingekommen, die Verständnisschwierigkeiten unter Menschen unterschiedlicher Sprachen ein für allemal durch Abschaffung der Wörter aus der Welt zu schaffen: „Als Ausweg ward infolgedessen offeriert, dass künftig jedermann, weil Wörter ja bloß Namen für die Dinge seien, bequemerweise die Dinge bei sich trage, die benötigt würden, um Sachen auszudrücken, über die man sich jeweils unterhalten wolle.“
Unter solchen Bedingungen muss eine Konversation unter Kapitänen in einer wahren Materialschlacht ausarten, wobei – apropos Nautik – bei Swifts Parodie auf die Seemannssprache auch die ganz generell blendend disponierte Übersetzerin zur Höchstform aufläuft: „Wir holten steuerbords die Schoten ein, warfen Luvbrassen und Toppnannten aus, strafften die Leerbrassen zogen die Luvbulinen ein und holten sie dicht, und schließlich holten wir den Besanhals über und hielten voll und bei, so gut es eben ging.“
Man sieht schon: Für eine juvenile Leserschaft muss der „Gulliver“ anständig aufbereitet werden, durchaus im Sinne von „anständig sprechen“, denn Swift zeigt einen starken Hang zu dem, was man heute als gross-out humour bezeichnen würde: Muss Gulliver abkacken, haben die armen Lilliputaner ordentlich was wegzuschaffen, und als er ein in den Gemächern der kaiserlichen Gemahlin ausgebrochenes Feuer „böswillig, verräterisch und teuflisch durch Abschlagen seines Urins“ löscht, zeigt sich Her Majesty not amused.
Überhaupt spielen Körperekel und Sexualängste eine auffällige Rolle: Wird der Held von einer Ehrenjungfer seiner neunjährigen brobdingnagnen Beschützerin Glumdalklitsch splitternackt ausgezogen und „der Länge lang in ihre Busenspalte“ gelegt, erfasst ihn ein alles andere als erotischer Schauer. Nachdem Gulliver jahrelang in der Gesellschaft von Pferden, jenen, den Menschen (= „Yahoos“) sittlich haushoch überlegenen Houyhnhnms, verbracht hat, wird die Rückkehr nach England zur eigenen Familie, die ihm ganz offensichtlich nicht im geringsten gefehlt hat, für ihn zum Horrortrip: „Wenn mich der Gedanke auch nur streifte, dass ich mit einer Yahoo-Frau das Bett geteilt und weitere Exemplare dieser Spezies gezeugt hatte, packten mich namenlose Scham, Bestürzung und Entsetzen.“
In ihrem Verkehrte-Welt-Schematismus sind „Gullivers Reisen“ mitunter etwas schlicht gestrickt, die Dekonstruktion des kolonialen Subjekts aber, die der dezidierte „Misanthrop“ Jonathan Swift hier leistet, ist nichts weniger als genial und visionär. Rund 150 Jahre vor Darwins „On the Origin of Species“ und ein weiteres Jahrhundert vor dem, was heute Postkolonialismus heißt, spiegelt sich der ethnologische Blick des Angehörigen einer vermeintlich überlegenen Zivilisation im Auge eines Pferdes und muss sich in diesem als Yahoo erkennen: ein schiacher Aff in Hemd und Hose.