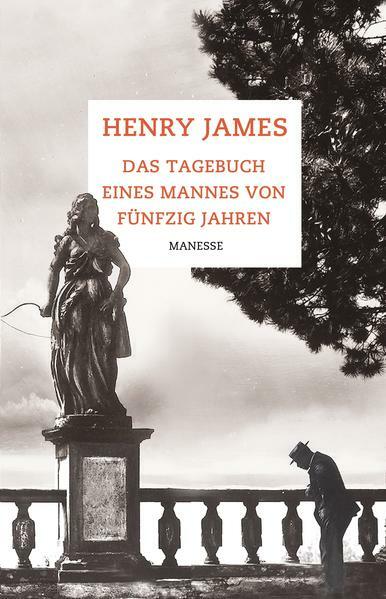Irrungen, Wirrungen
Sebastian Fasthuber in FALTER 15/2015 vom 08.04.2015 (S. 35)
Zweifeln am Selbst: Der amerikanische Schriftsteller Henry James seilte sich in die Tiefen der menschlichen Seele ab. Nun sind seine Erzählungen neu übersetzt erschienen
Man behaupte nie, bis ins Letzte über ein menschliches Herz Bescheid zu wissen.“ Mit diesem Satz hebt die Erzählung „Louisa Pallant“ an, und damit beginnt auch „Das Tagebuch eines Mannes von fünfzig Jahren“, ein Band mit Erzählungen von Henry James (1843–1916), die der an James Joyce geschulte Friedhelm Rathjen ins Deutsche übersetzt hat. Der Satz wie das Buch sind ein guter Einstieg ins Werk eines der größten und dafür erstaunlich wenig gelesenen Autoren.
Im Gegensatz zu Marcel Proust, Leo Tolstoi oder dem von ihm sehr verehrten Charles Dickens ist Henry James im deutschsprachigen Raum nie wirklich angekommen. Was zum Teil am hochgestochenen Ton seiner Romane und Erzählungen liegt, die nicht um den Leser buhlen, sondern von ihm erobert werden wollen. In gewisser Weise blieb James immer ein Außenseiter. Literarisch liegt sein Platz zwischen den Stühlen und Epochen. Und in der europäischen Oberschicht, deren Nähe er suchte und über die er trefflich schrieb, wurde er als gebürtiger Amerikaner auch nie ganz heimisch.
Als Sohn des Intellektuellen Henry James Sr., der von Ralph Waldo Emerson bis Henry David Thoreau mit so ziemlich allen wichtigen Autoren und Denkern seiner Zeit bekannt war, wuchs er in einer ebenso gebildeten wie wohlhabenden Familie auf. Die James-Kinder sollten mit der Kultur der Alten Welt vertraut sein. Aus dem Grund brachte ihr Vater ihnen nicht nur die englische, französische und deutsche Literatur näher, er reiste mit ihnen auch jahrelang durch Europa. Sein Schriftstellersohn sollte sich später in England niederlassen.
Henry James war nicht der einzige berühmte Spross der Familie. Sein Bruder William gilt als Begründer der amerikanischen Psychologie. Er prägte den für die Literatur später noch sehr wichtigen Begriff „Bewusstseinsstrom“ und seine Beschreibung des Selbst ging in die Geschichte der Entwicklungspsychologie ein. William James glaubte nicht mehr an ein einziges „Ich“, für ihn teilte es sich in ein erlebendes Subjekt „I“ und ein reflektierendes Objekt „Me“ auf. Erst zusammen ergeben sie als Ganzes das „Self“.
Henry James interessierte sich stark für die Arbeiten des älteren Bruders und ließ dessen Erkenntnisse in seine literarischen Werke einfließen. Seine psychologischen Romane und Erzählungen stehen dadurch schon an der Schwelle zur Moderne. Abgesehen von Shakespeare kannte kaum ein Schriftsteller den Menschen so genau wie James, doch konnte dieser nicht mehr so tun, als ließe sich etwas mit letzter Gewissheit feststellen.
Das große Thema seines Werks sind verpasste Chancen und Leidenschaften, Täuschungen und Intrigen. Viele seiner Helden sind Amerikaner, die versuchen, die für sie komplizierten Codes und Rituale der besseren Gesellschaft Europas zu verstehen. Oft handelt es sich um Männer, die sich in europäische Frauen verlieben, aber nicht aus diesen schlau werden.
Der Erzähler von „Louisa Pallant“ etwa war vor vielen Jahren unglücklich in die titelgebende Figur verliebt. Als er sie überraschend wieder trifft, ist auch ihre Tochter zu einer Schönheit herangereift. Sie verdreht nunmehr seinem naiven Neffen, der erstmals in Europa weilt, den Kopf. „Nun, wir werden ihn nicht umbringen, was, Linda?“, scherzt Louisa Pallant. Die Tochter erwidert mit einem Lächeln: „Ich weiß nicht – vielleicht doch!“ So weit kommt es nicht, aber am Ende wird der verwirrte Jüngling überstürzt abreisen.
Das Meisterstück in dem Band stellt die in Tagebuchform geschriebene Titelerzählung dar. Ein Amerikaner kehrt darin nach einer Karriere beim Militär nach gut einem Vierteljahrhundert nach Florenz zurück, wo er einst sein Herz verlor: „Man erklärte mir, ich würde Italien sehr verändert finden; und siebenundzwanzig Jahre lassen durchaus Raum für Veränderung. Doch für mich ist alles so vollkommen dasselbe geblieben, dass ich meine Jugend von Neuem zu durchleben vermeine (…).“
Der Mann hat eine fixe Idee, von der er nicht abzubringen ist. Die Gräfin Salvi-Scarabelli habe ihm einst übel mitgespielt, als sie ihm schöne Augen machte, später jedoch einen anderen heiratete. Wobei sich nach und nach herausstellt, dass er damals einfach nicht die Schneid hatte, wirklich um sie zu werben. Sein eigenes Scheitern überträgt er nun auf einen jungen Mann, der sich unsterblich in die Tochter der Gräfin verliebt hat.
„Sie erinnern mich an mein jüngeres Ich“, sagt der Alte. Und warnt: „Die Mutter war eine äußerst gefährliche Frau.“ Seiner Logik zufolge muss das auch für die Tochter gelten. Egal, was diese tut oder sagt, er legt es ihr zum stets Schlechtesten aus: „Ah, sie ist eine versierte Frau!“ Die bittere Pointe der Erzählung ist, dass die inzwischen schon verstorbene alte Gräfin nur auf ein Zeichen von ihrem Verehrer gewartet hätte.
„Ihr fehlte es komplett an dem, was ich Leben nennen würde“, heißt es in einer anderen Erzählung. Das galt auch für Henry James, der unter melancholischen Zuständen litt und sich das Leben am liebsten vom Leib hielt. Wie viele seiner Figuren blieb er unverheiratet. Die Damen der englischen Gesellschaft sollen ihn als ausgezeichneten Zuhörer geschätzt haben, schreibt Meike Albath in ihrem Nachwort. Ihre Konversationen dienten ihm als Material für seine brillanten literarischen Versuchsanordnungen.