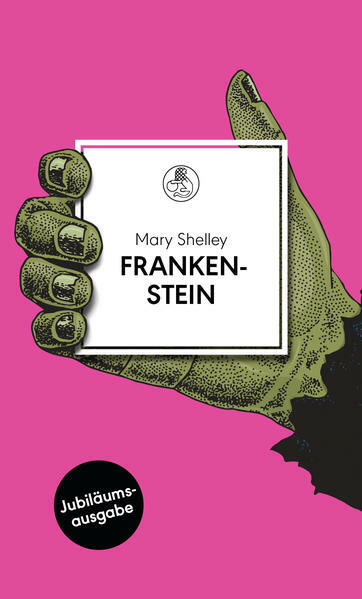Inside Frankenstein
Jutta Person in FALTER 41/2017 vom 11.10.2017 (S. 22)
Die Urfassung von Mary Shelleys Klassiker offenbart ein Grauen, das über das wohlige Gruseln weit hinausgeht
„Ich war entzückt, als ich erstmals entdeckte, dass ein angenehmer Ton, der häufig meine Ohren erfreut hatte, aus den Kehlen kleiner geflügelter Tiere stammte, die mir oft schon aufgefallen waren. Manchmal versuchte ich, den fröhlichen Gesang der Vögel nachzuahmen.“ Daraus wird leider nichts, denn aus der eigenen Kehle kommen nur sehr grobe Töne, wie das entzückte Wesen betreten feststellen muss. Trotzdem versucht es unermüdlich, seine Gefühle zu verfeinern: Es bringt sich das Lesen bei und sucht sehnsüchtig nach Familienanschluss – eine éducation sentimentale, die ans Herz geht. Wie gut, dass es im Wald zufällig eine Mappe mit Büchern findet – darin Goethes „Leiden des jungen Werthers“ und Miltons „Paradise Lost“ –, mithilfe derer sich das empfindsame Monster neue Horizonte der Empathie erschließt.
Monster? Genau, wir befinden uns mitten im Lebensbericht der künstlichen Kreatur aus Mary Shelleys Klassiker „Frankenstein“, der jetzt in der Urfassung von 1818 erschienen ist. Man übertreibt wohl nicht, wenn man die tränenseligen Bekenntnisse des jungen Monsters als Schlüsseldokument sozialutopischer Milieuforschung liest. Wie aber kommt es dann, dass der sensible Werther-Fan ein unschuldiges Kind, den besten Freund sowie die Braut seines Schöpfers erwürgt? Seine Gewalt sei nur ein stummer Schrei nach Liebe, lässt die bei der Niederschrift erst 18-jährige Mary Shelley das Monster selbst erklären: „Ich bin bösartig, weil ich unglücklich bin. Werde ich nicht von allen Menschen geschmäht und gehasst?“
Bekanntermaßen hat sein Schöpfer Victor Frankenstein das Rohmaterial nicht allzu sorgfältig zusammengesetzt; das Monster beginnt ihn zu verfluchen und fordert eine Frau, die ebenso hässlich und missgestaltet sein soll wie es selbst. Der monströse Lebensbericht ist das Herzstück einer Serie von Bekenntnissen, die matroschkapuppenhaft ineinandergestapelt sind.
Ganz an den Anfang setzt Mary Shelley den Entdecker Robert Walton, der von grenzenlosem Ehrgeiz bis zum Nordpol getrieben wird. Dessen innige Briefe an seine Schwester erklären nicht nur Waltons Eroberungsdrang, sondern vermerken auch, dass das Expeditionsschiff im Eis stecken bleibt – und ein halb erfrorener Fremder auftaucht: Frankenstein, der seiner entgleisten Kreatur hinterherjagt. Der wiederum lässt eine lange Lebensbeichte folgen, die auch von der Begegnung mit „dem Dämonen“ mitten in der majestätischen Gletscherwelt des Montblanc berichtet. Frankensteins Erzählung soll dem jungen Forscher-Alter-Ego Robert Walton zur Mahnung gereichen: Maßloser Wissensdrang kann Übles anrichten!
Es ist nicht zuletzt diese Warnung, die aus der zunächst gar nicht so erfolgreichen Gruselgeschichte – ungekürzter Titel: „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ – einen weltberühmten Klassiker gemacht hat. Spätestens seit der Verfilmung von 1931 ist „Frankenstein“ der Archetyp für den „mad scientist“ aus den Lebenswissenschaften, der sich gottgleiche Kompetenzen anmaßt – und für sein Monster, das zwar das Gegenteil eines Designerbabys ist, aber dennoch eine Bedrohung für den natürlichen Fortbestand der Menschheit darstellt.
Das Bestechende an der neuen Ausgabe der Urfassung besteht nun genau darin, dieser Lesart einige Varianten hinzuzufügen. Georg Klein, der zuletzt den Roman „Die Zukunft des Mars“ veröffentlicht hat, weist in seinem Nachwort auf das vielfach übersehene Grauen hin, das von zwei genial gewählten Schauplätzen ausgeht: den Eisschollen am Nordpol und den Gletschern am Montblanc. Diese erhabenen Orte der unbelebten Natur strahlten, so Klein, höchst unheimlich auf ihren belebten Part zurück. Mit ihrem weißen Schimmern wirken die Alpengipfel, „als gehörten sie zu einem anderen Planeten“ (Frankenstein), und wie immer, wenn Erhabenheitskulissen ins Spiel kommen, wirkt das eigene Leben davor belanglos.
„Hier wird die Tatsache, dass überhaupt etwas lebt und aus eigener Kraft selbst gegen die widrigsten Umstände fortwest, zum Ursprung eines abgrundtiefen Grauens“, erklärt Klein, und die Konsequenzen könnten kaum einschneidender sein: „Die sogenannte Natur und das sogenannte Leben, also das scheinbar Vertrauteste und romantisch Heimelige, verstehen sich plötzlich nicht mehr von selbst.“
Ob das Leben, dieses Gewürm-Gewimmel diesseits des ewigen Eises, nun auf natürliche oder künstliche Weisen entstanden ist, spielt – so könnte man „Frankenstein“ auch lesen – nur noch eine vernachlässigenswerte Rolle; womit Mary Shelley zu einer Ahnherrin des postmodernen Romans avanciert.
Fragt sich nur, wie das ein Teenager zu Beginn des deutlich vor-postmodernen 19. Jahrhunderts bewerkstelligen konnte. Tatsächlich waren die Lebensumstände Mary Shelleys alles andere als gewöhnlich: Ihr Vater war der Sozialphilosoph und Anarchist William Godwin, ihre Mutter, Mary Wollstonecraft, wurde als Verfasserin der „Verteidigung der Rechte der Frau“ berühmt. Sie starb kurz nach der Geburt Marys im Jahr 1797, und so wuchs die Tochter in der Obhut des Vaters auf, der seine Kinder nach libertären Prinzipien erzog, die von Mary wortwörtlich genommen wurden: Sie verliebte sich in den Dichter Percy B. Shelley und brannte mit ihm durch.
Es folgte eine Reise quer durch Europa und ein Leben weit jenseits bürgerlicher Normen. Aus heutiger Sicht könnte man die Gruppe, die 1816 am Genfer See gastierte, vielleicht als polyamoren Hippie-Schreibzirkel bezeichnen. Mit von der Partie waren neben Mary und Percy Shelley auch Lord Byron, dessen Arzt John Polidori und Marys Stiefschwester Claire, die mit Byron liiert war.
Dieses „Jahr ohne Sommer“ war so verregnet, dass man sich mit dem Schreiben von Gespenstergeschichten unterhielt. In ihrem Nachwort zur späteren Ausgabe von 1831 berichtet Mary Shelley von den gemeinsamen Gesprächen, die von der Elektrizität über den Galvanismus bis zur Frage nach dem Ursprung des Lebens reichten. Und sie fügt hinzu, dass sie in der späteren Fassung des Romans kaum etwas verändert habe.
Das stimmt allerdings nicht, denn die radikalen Ideen und Lektüren ihres Freundeskreises zeigen sich in der Urfassung viel deutlicher, wie die Anmerkungen des Übersetzers und Mary-Shelley-Biografen Alexander Pechmann belegen. Seine Übersetzung eröffnet ein Gefühlspanorama des Monsters und Forschers um 1800, in dem sowohl das Klagelied der Kreatur als auch die Selbstzerstörung des Kreators detailverliebt ausgestaltet werden.
Vielleicht muss man zuerst das konventionell vernarbte Filmmonster beiseiteschieben – um einen Klassiker zu entdecken, der sensationslustig seufzt und tränenreich ins Verderben führt. Zur „Grundlage des Lebens“ muss aber auch Mary Shelley schweigen, und das treibt den Gruselfaktor ins Unendliche.