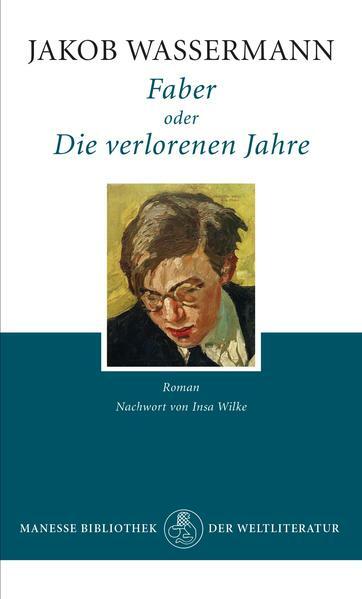Das Abendland auf dem Prüfstand
Alfred Pfoser in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 8)
In „Faber oder Die verlorenen Jahre“ zeichnet Jakob Wassermann (1873–1934) ein drastisches Bild der Weimarer Republik
Jakob Wassermann galt einst als einer der bekanntesten und erfolgreichen deutschen Schriftsteller. Sein Name wurde vor und nach dem Ersten Weltkrieg in einem Zug mit jenem von Thomas oder Heinrich Mann genannt. Seine Auftritte, auch im fremdsprachigen Ausland, waren viel beachtet. Zugleich geriet er, der sich als Jude und Deutscher verstand, zunehmend ins Visier der nationalistischen Fronde. 1933 wurden seine Bücher in NS-Deutschland verbrannt und verboten. In den vergangenen Jahrzehnten erschienen zwar einige seiner Romane in Reprints, aber die literarische Reputation von einst stellte sich nicht wieder ein.
Jetzt ist in der schmucken Manesse-Edition einer der unbekannteren Romane Wassermanns wieder aufgelegt worden. „Faber oder Die verlorenen Jahre“, erstmals 1924 publiziert, führt mitten hinein in die unmittelbare Nachkriegszeit.
Eugen Faber ist ein Kriegsheimkehrer, zerstört von sechs Jahren Gefangenschaft, misstrauisch, bedürftig. Keine angenehme Figur, in der inneren Heimatlosigkeit ein Verwandter von Joseph Roths Protagonisten, die auch nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg nicht und nicht ankommen wollten und konnten.
Wassermann stellt seinen „Faber“ mitten hinein ins turbulente Nachkriegsdeutschland, lässt ihn in eine Ehekrise fallen und auf die diversen Familienmitglieder prallen und die großen ideologischen Auseinandersetzungen widerhallen. Es ist eine ziemlich grelle Mischung, in deren Zeitkritik sich die politischen und ideologischen Auseinandersetzungen spiegeln, sich kleine Dramen und große Tragik ereignen und in der auch noch Platz ist für erotische Abgründe.
Im Mittelpunkt steht dabei eine etwas seltsame „Fürstin“, die herummarodierende Kinder in einer Kinderstadt sammelt und mit ihren magischen Heilskräften die Bevölkerung in ihren Bann schlägt. Aus aristokratischem Boden wachsen bei Wassermann edle Charismatikerinnen empor.
Die leidenschaftlich erzählte Geschichte lässt sich leicht lesen, mit heißem Atem werden Lebensbeichten abgelegt. Die Not der Zeit entfacht die Not der Seelen. Die Figurenporträts ergeben dabei ein plastisches Bild der Weimarer Republik, weisen dabei allerdings – auch in der Sprache – stets eine Tendenz zu heftigen Farben, düsteren Szenarien und melodramatischen Konstellationen auf. Revolutionäre rotten sich in düsteren Quartieren zusammen und missbrauchen junge Frauen, Fabers erotische Bedürfnisse bedrängen das Kindermädchen. Viel Heilsbedürfnis schwirrt herum, Sehnsucht nach Reinheit, Achtung und Liebe, Erlösungsfantasien, gespeist aus Verzweiflung.
Es ist nicht das materielle Elend, mit dem uns Wassermann konfrontiert, sondern der sogenannte „Zerfall der Werte“. Als erstrangige Krisenherde richten die Emanzipation der Frau oder die liberalen Erziehungsprinzipien in diesem Roman einiges Unheil an, ja, sie heben die Welt aus den Fugen.
Fabers Frau liebt ihren Beruf, Fabers Mutter huldigt einem antiautoritären Prinzip. Das kann nur schiefgehen, wie sich am 16-jährigen Enkel erweist: Der schlägt sich in Bars herum, nimmt Kokain und stiehlt die Diamanten der Tante. „Faber oder Die verlorenen Jahre“ ist ein Roman über den Niedergang einer Familie, windschief konstruiert, mit einem ziemlich buntscheckigen Personal. Der Autor zeigt sich als enagierter Moralist. Bei allem Theaterdonner steht das Abendland auf dem Prüfstand.
Das zeitgenössische Publikum hat Wassermanns Literatur geliebt, konnte sich in dieser wiederfinden, hat im Dekorativen und Dämonischen, im Kolportagehaften und Angespannten seiner Zeitkritik mitgefiebert, weil es die großen Themen abgehandelt fand. Heute wirkt dieser leidenschaftliche Ernst bei aller Erzählkraft ein wenig komisch. Das Nachwort wünscht den Autor als Diagnostiker und Wahrheitssucher wieder in den Kanon zurück. Das wird sich nicht ganz ausgehen.