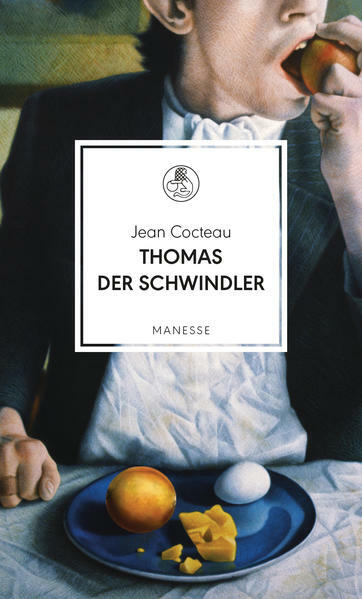Die Schrecken des Krieges und des Ennui
Klaus Nüchtern in FALTER 23/2018 vom 06.06.2018 (S. 28)
Mit „Thomas der Schwindler“ schrieb Jean Cocteau einen ebenso leichtfüßigen wie abgründigen Schelmenroman
Seit Grimmelshausens „Simplicissimus“ weiß man, dass der Krieg auch seine Schelme hat. Und der Erste Weltkrieg hat nicht nur den vermeintlich braven Schwejk, sondern auch Thomas, den Schwindler. Im Unterschied zu Jaroslav Hašeks Opus magnum, das Fragment bleibt, vollendet Jean Cocteau seinen „Thomas“ in wenigen Wochen, der schmale Roman erscheint 1923, im selben Jahr also, in dem der Verfasser des „Schwejk“ mit nur 39 Jahren stirbt.
Viel unterschiedlicher können zwei Autoren – der aus einfachen Verhältnissen stammende, wuchtige Alkoholiker und der zeitlebens aller materiellen Sorge enthobene, opiumsüchtige Spätabkömmling der Belle Epoque – nicht sein, und auch ihre Werke und Helden sind danach.
Während Hašeks Offiziersdiener ein Drückeberger ist, schwindelt sich Cocteaus blutjunger Protagonist nicht um den Krieg herum, sondern in diesen hinein – wozu er sich als 17 ausgibt, obwohl er erst 16 Jahre alt ist. Er tut dies übrigens allem Anschein nach nicht aus Patriotismus oder der „Sache“ wegen, sondern weil ihm die Schrecken der Langeweile schlimmer dünken als diejenigen des Krieges.
Dass hier ein autobiografischer Hintergrund besteht, kann kaum geleugnet werden. „Cocteau“, so schreibt die Literaturkritikerin und Romanistin Iris Radisch in ihrem Nachwort, „lebt bis zum Kriegsbeginn ausschließlich im luftdicht verschlossenen Kokon der Pariser Oberschicht, deren größte Bedrohung nicht das deutsche Kaiserreich, sondern der Ennui ist, dem sie mit den Waffen des Esprit und der Extravaganz begegnet.“
Der junge Cocteau selbst wird für dienstuntauglich befunden, trägt aber „eine elegante, spezialangefertigte blaue Fantasie-Offiziersmontur“, und André Gide äußert sich abfällig über den um 20 Jahre jüngeren Kollegen: „Er verzichtet auf nichts, färbt lediglich seine unbändige Art ein wenig martialisch. Um von der Metzelei bei Mühlhausen zu sprechen, erfindet er amüsante Beiworte und Gesten.“
Von dieser Manier ist auch der Roman nicht frei. In einem Zelt siechen 30 Verwundete auf Strohballen dahin, und der Autor zieht alle Register, klimpert auf der Klaviatur seiner Bildung: „Ein unbeschreiblicher, süßlicher Geruch, zu dem sich das schwarze Moschusaroma des Wundbrandes gesellte, drehte einem dem Magen um. Die einen hatten aufgedunsene, gelbe, mit Fliegen bedeckte Gesichter; andere hatten die Blässe, die Magerkeit, die Gebärden der Mönche des El Greco.“
Die Fiktion ist freilich auch nach einem realen Fall modelliert, und so wie sich ein gewisser Raoul Thomas aus Castelnau, dem der Autor im Jahr 1914 begegnet ist, als Neffe eines berühmten Generals ausgab, nutzt Cocteaus Thomas, der mit vollem Namen Guillaume Thomas de Fontenoy heißt, eine zufällige Namensgleichheit für das nämliche Manöver. Es bereitet ihm weiter keine große Anstrengung, was zum einen an seinem gewinnenden Äußeren – „Sein Gesicht, frisch, animalisch, hübsch, verschaffte ihm überall schneller Einlass als jedes Zeugnis“ –, zum anderen daran liegt, dass viele der involvierten Personen – Damen und Herren der besten Gesellschaft, unter denen sich auch eine Prinzessin befindet – den Krieg als unterhaltsames Spektakel auffassen, an dem sie sich ein bisschen beteiligen wollen: „Sie drangen in die Kulissen des Dramas vor. Die Bühne kam näher, und sie betrachteten diese Einsamkeit, die Bäume rechts und links, die von Kanonendonner erfüllte Nacht. Glichen sie nicht jenen Musikliebhabern auf der Galerie, die, über einen schwarzen Abgrund gebeugt, Strawinsky lauschen? Sie wurden der endlosen Fahrt nicht müde. Sie ertrugen den braunen Geruch der Schlachtfelder, den eintönigen Lärm des einstürzenden Horizonts.“
In einem Milieu, dem alles zur Verfügung steht, wird sogar die Monotonie des Krieges zur willkommenen Abwechslung: Man organisiert Verwundetentransporte in Kutschen und nutzt die Gefährte zugleich, um Geranientöpfe auf sein ländliches Anwesen zu befördern. Ob man das als Zynismus oder die Darstellung von Zynismus auffassen soll, ist schwer zu entscheiden. Eine Differenz zwischen der Figurenperspektive und jener des Erzählers ist jedenfalls nicht auszumachen, kritische Kommentare gibt es keine.
Die Schrecken des Krieges werden allerdings auch nicht ausgeblendet. Als der groteske Upper-Class-Charity-Tross eine gefangengenommene Ambulanz des Feindes besucht, wird er Zeuge, wie der deutsche Stabsarzt in der Finsternis den Verwundungsgrad der Verletzten überprüft: „Er stocherte mit der Mistgabel herum. Das war sein Ausleseverfahren. Die am schwersten Getroffenen schrien am lautesten.“
Das Ethos des Romans liegt vielleicht gerade darin, dass dieser nichts beschönigt oder heroisiert: weder den Krieg noch die frivole Haltung seines Personals. Auch wird auf die Unterstellung jeder tieferen Bedeutsamkeit verzichtet: keine reinigenden Stahlgewitter, keine Katharsis, kein Triumph der Humanität im Angesicht der Katastrophe. Der Krieg ist ein sinnbefreiter Selbstläufer: „Draußen hörte man nur hin und wieder ein paar Schüsse, die man abzufeuern schien, um den Krieg in Gang zu halten.“
Die Liebeshändel, Eifersüchteleien und Eitelkeiten der handelnden Personen scheinen davon nicht berührt – bis auch sie ereilt, was gerne als „Einbruch des Realen“ bezeichnet wird. Am Ende ist es die blutige Wirklichkeit, die die Simulation auf tragische und vielleicht auch komische Weise beglaubigt. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.