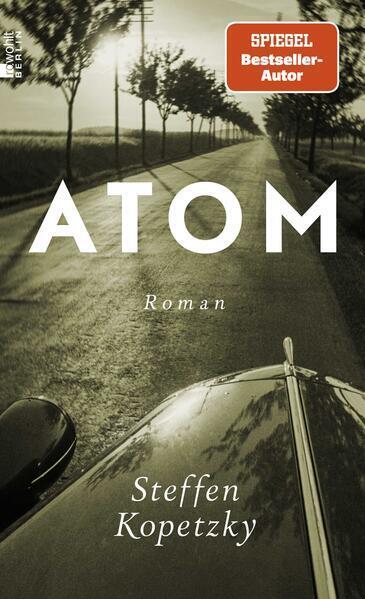Der Spion, der sie liebte
Verena Moritz in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 12)
Die Rahmenhandlung von Steffen Kopetzkys Roman „Atom“ ist schnell erzählt. Der britische Physiker Simon Batley studiert im Berlin der 1920er-Jahre und beginnt dort, dem Geheimdienst seines Heimatlandes zuzuarbeiten. Während des Zweiten Weltkriegs wird er von den Briten reaktiviert und der Abteilung „Scientific Intelligence“ zugeteilt. Im Fokus seiner Tätigkeit steht die Informationsbeschaffung über die nationalsozialistische Raketenentwicklung und Atomforschung.
In Bletchley Park überzeugt er sich von den Erfolgen einer beeindruckenden Abhörmaschinerie. Nicht zuletzt mit ihrer Hilfe gelingt es, den Machenschaften der Nazis auf die Spur zu kommen, Produktionsstätten auszukundschaften, aber auch Hinweise auf die zentralen Figuren rund um die deutschen Geheimwaffen zu erhalten.
Bis Batley an den organisatorischen Kopf der in einem unterirdischen Tunnelsystem vorangetriebenen und auf Zwangsarbeit Tausender basierenden „Wunderwaffenherstellung“ herankommt, begleiten ihn Leserin und Leser entlang vieler Episoden, deren Stimmungslagen aus Spionageromanen und -filmen älteren wie jüngeren Datums bekannt sein dürften: einsame Momente in düsteren Wohnungen; tiefschürfende Gespräche mit Kollegen über den Sinn des eigenen Tuns inmitten einer in Blut versinkenden Welt; Mutmaßungen über den Aussagewert abgefangener Nachrichten; Verfolgungsjagden und schließlich schmerzliche Reminiszenzen an eine jäh beendete Liebe.
Die angebetete „Hedi“ ist eine deutsche Mathematikerin – ihr voller Name lautet Hedwig von Treyden – und gehört zu jenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die das bedrängte „Dritte Reich“ vor der Niederlage bewahren sollen – was bekanntlich misslingt. Parallel dazu ist das Wissen über die NS-Technologie weiterhin begehrt. Als sich der Krieg seinem Ende nähert, gilt das Interesse der Amerikaner nicht nur den involvierten NS-Wissenschaftlern, sondern auch dem Hauptorganisator des gesamten Unternehmens, Hans Kammler, General der Waffen-SS.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Steffen Kopetzky historischer Vorlagen bedient. 2023 war es die schillernde Kommunistin Larissa Reissner, deren Biografie im Roman „Damenopfer“ zwischen „Affären und Weltrevolution“ aufbereitet wurde. Schon damals musste eine enorme Anzahl an Figuren und Nebenhandlungen im Auge behalten werden, „Atom“ nun stellt seine Leserschaft vor ähnliche Herausforderungen. Weitverzweigte Spionagenetzwerke warten naturgemäß mit einer Vielzahl an Namen und Pseudonymen auf. Neben diesem „Fußvolk“ tritt eine Reihe prominenter Figuren auf – von Albert Einstein, Winston Churchill und Rudolf Heß bis zum James-Bond-Erfinder Ian Fleming.
Sprachlich souverän packt Kopetzky seinen Agentenroman in geschmeidige Dialoge. Die nachdenklichen Betrachtungen, die vor allem seine Hauptfigur, Simon Batley, anstellt, vermitteln ein plausibles Bild vom Wesen des integren Agenten. Die komplexe Psychologie, die sich hinter der Spionage und den Geheimen Diensten auftut, hat allerdings Michael Ondaatje in seinem Roman „Kriegslicht“ sprachlich subtiler und kompositorisch raffinierter sichtbar machen können. Wer überdies John le Carrés desillusionierten Alec Leamas aus „Der Spion, der aus der Kälte kam“ kennengelernt hat, wird das innere Ringen von Simon Batley auf einem anderen, vielleicht ein wenig brav konstruierten Reflexionsniveau verorten.
Darüber hinaus ist der Bezug auf einen authentischen Hintergrund doch etwas penetrant geraten. Die permanente Berufung auf Ereignisse und Personen, die der Geschichte entnommen sind, wirft schließlich sogar die Frage auf, ob nicht die Lektüre eines Sachbuchs vorzuziehen wäre. Ein solches würde einen gesicherten Erkenntnisgewinn bei ebenfalls vorhandenem Unterhaltungswert liefern, der auch einer akademisch betriebenen Intelligence History im Regelfall niemals ganz abhandenkommt.
In seinem Nachwort gibt der Autor zu bedenken, dass weite Teile der deutschen Geheimforschung der NS-Zeit von dichtem Nebel umgeben seien. So etwa sind auch das Wirken und die Bedeutung Hans Kammlers, der als Koordinator geheimer Waffenprogramme in der letzten Phase des NS-Regimes eine Schlüsselposition innehatte, tatsächlich weitgehend unerforscht geblieben.
Dafür verantwortlich war allerdings nicht zuletzt eine bewusste Desinformation von amerikanischer Seite. Die Geschichte um Kammlers fingierten Selbstmord, den er im Mai 1945 begangen haben soll, enthält all jene nachrichtendienstlichen Klischees, die fiktionale Annäherungen an den „Krieg im Dunkeln“ mühelos in den Schatten stellen. So weist etwa eine 2019 ausgestrahlte ZDF-Doku über „Hitlers Geheimwaffenchef“ auf den mysteriösen Umstand hin, dass der zu Kriegsende umgekommene Chauffeur Kammlers in Gmunden unter seinem tatsächlichen Namen gleich zweimal bestattet wurde und dass dessen Identität möglicherweise dazu diente, die Spuren des SS-Chefs zu verwischen. Erst Jahrzehnte später meldete sich einer der Söhne des für Kammlers „Verschwinden“ verantwortlichen amerikanischen Agenten zu Wort und präsentierte erhellende Details über den damaligen Auftrag seines Vaters.
Eine gründliche wissenschaftliche Aufarbeitung von „Hitlers Raketen“ und des bis heute andauernden Streits um den tatsächlichen Stand der deutschen Atombombenforschung steht nach wie vor aus. Die Lektüre von Kopetzkys „Atom“ lässt einmal mehr hoffen, dass dieses Projekt endlich vorangetrieben wird. Neugierig macht der Roman allemal.
Verena Moritz