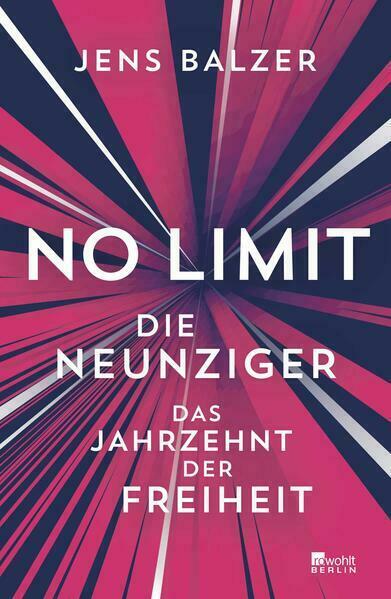"Nicht alle wollen DEMOKRATIE UND LIBER ALEN KAPITALISMUS"
Gerhard Stöger in FALTER 25/2023 vom 21.06.2023 (S. 32)
Die 90er beginnen für Jens Balzer mit dem Fall der Berliner Mauer und enden mit dem Terroranschlag vom 11. September 2001. In seiner Analyse "No Limit" verknüpft der deutsche Autor die politische und gesellschaftliche Entwicklung dieser hoffnungsvollen Ära kenntnisreich und gut lesbar mit ihrer Popkultur.
"No Limit", benannt nach einem Eurodance-Hit, schließt an seine Bücher über die Seventies ("Das entfesselte Jahrzehnt") und die Eighties ("High Energy") an. Es führt von den "temporären autonomen Zonen" im Techno-Berlin zu den "national befreiten Zonen" des deutschen Ostens, vom Turbofolk des zerfallenden Jugoslawiens zu den Heilsversprechen des Internets und von Nirvana bis zur Love Parade.
Balzer spannt einen Bogen von der Fatwa gegen Salman Rushdie über die Körperpolitik am Strand von "Baywatch" bis zum Versagen in Sachen Klimaschutz. Von der Dekade bleibt letztlich vor allem eines: große Ernüchterung über ein neues Erstarken nationaler Identitäten und derlei Fehlentwicklungen mehr. Das sei ihm beim Schreiben auch aufgefallen, sagt der Autor: "Ich ging da euphorischer rein, als ich rauskam."
Falter: Herr Balzer, erinnern Sie sich noch, wie Sie 1994 vom Tod des Nirvana-Sängers Kurt Cobain erfahren haben?
Jens Balzer: Nicht wirklich. Aber ich erinnere mich noch gut an das einzige Konzert von Nirvana, das ich gesehen habe. Im August 1991, im Club Aladin in Bremen. Sie waren da als Vorgruppe von Sonic Youth, meiner damaligen Lieblingsband. Nirvana spielten knapp 45 Minuten, bis Kurt Cobain rückwärts ins Schlagzeug fiel und das Konzert damit vorzeitig beendet wurde. Aus denen wird nie was, dachten wir alle. Obwohl sie einen neuen Song dabei hatten, den wir ganz gut fanden, "Smells Like Teen Spirit".
Mit diesem Song sollte die Karriere der Band bald darauf explodieren.
Balzer: Gerade mal drei Monate später spielten Nirvana in der Hamburger Markthalle. In meiner Arroganz hatte ich mir keine Vorverkaufskarte besorgt, und als ich am Abend hinkam, stand da eine fünf Kilometer lange Schlage, einmal rund um den Hauptbahnhof. Cobains Tod wurde in meinem Umfeld nicht als individuelles Schicksal wahrgenommen, sondern als Ende des langen Weges, den Alternative Rock aus dem Underground der 80er in den Mainstream der 90er zurückgelegt hatte.
Kurt Cobain war eine Symbolfigur.
Balzer: Vor ihm kannte diese Musik jene Handvoll Eingeweihter, die für Fanzines schrieben und später Popkritiker wurden. Über den Umweg MTV brachte Cobain diese Musik den Massen nahe. Für mich war es nach seinem Tod mit Rockmusik erst mal vorbei, Techno und Drum'n'Bass wirkten ungleich reizvoller.
Die Popkultur der 70er beschreiben Sie als von Veränderung geprägt, die 80er hingegen als Epoche des Rückgriffs auf Altbekanntes, während die 90er den Unterschied zwischen Innovation und Nostalgie aufgehoben hätten. Wie meinen Sie das?
Balzer: Man denke nur an eine TV-Serie wie "Simpsons" oder den Kinofilm "Pulp Fiction": Beides steht exemplarisch dafür, dass es in den 90ern vor allem um das Zitat ging und darum, augenzwinkernd Reverenzen zu erweisen, gern auch für Insider. Du kannst einfach so zuschauen, du kannst dich aber auch auf die Suche nach all den Anspielungen machen. Was die Philosophie und Literaturtheorie der 1970er als Postmoderne bezeichnete, ist in den 90ern komplett in der Popkultur angekommen: Man bewegt sich in einem Universum, in dem jedes Zeichen auf ein anderes Zeichen verweist.
Was wäre ein musikalisches Beispiel dafür?
Balzer: Die Spice Girls als erste wirklich erfolgreiche britische Girlgroup stehen für ein gigantisches Feuerwerk an Referenzen auf vergangene Popepochen. Generell haben die 90er kaum Künstler hervorgebracht, die etwas radikal Neues machten -erst recht nicht erfolgreiche. Es geht erstmals vorrangig darum, die Inhalte der Archive immer wieder neu zu vernetzen. Das korrespondiert mit der Idee des in dieser Zeit langsam aufkommenden Internets: Man kann jetzt alles mit allem verknüpfen, und immer entsteht irgendwas Überraschendes daraus.
Wie passt die Techno-Kultur in ihrer bewussten Anonymität dazu?
Balzer: Als Kehrseite der Medaille. Musikalisch wollte Techno gar keine Referenzen, sondern einfach nur das große Bummbummbumm des reinen Rhythmus. Semiotisch betrachtet ging es in den 90ern mit Techno einerseits zum absoluten Nullpunkt, andererseits mit der späten Postmoderne im Pop zum unbedingten Maximalismus, der ständigen Überbietung. Von wegen, was wir nicht alles wissen! Samuel L. Jackson muss in seiner "Pulp Fiction"-Rolle als Auftragsmörder an einer Stelle ein "Krazy Kat"-T-Shirt tragen, weil die paar Comicexperten dann genau wissen, dass das etwas mit masochistischer Liebe zu tun hat und es obendrein der erste Comic eines schwarzen Comiczeichners war.
Die Spice Girls bezeichnen Sie als "zugleich postmodern progressiv und antimodern reaktionär". Klingt widersprüchlich.
Balzer: Ist es aber vielleicht gar nicht, weil in den 90ern ohnehin alles ständig durcheinanderging. Die Spice Girls waren für viele um 1990 geborene Frauen eine Art erstes feministisches Empowerment. Gleichzeitig erklärten sie sich zu den größten Thatcher-Fans und lehnten die Europäische Gemeinschaft als "Gleichmacherei" ab. Ihr 1997 erschienener Film "Spiceworld" ist ein einziges Zeichengestöber, das übergeht vor Zitaten. Alles wird aufgelöst, nur eines nicht: der britische Nationalstolz, darum prangt der Union Jack auf dem Tourbus.
Einerseits also Empowerment, andererseits Nationalismus? Balzer: Gepaart mit neoliberaler Arroganz. Im Video zu ihrem ersten Hit "Wannabe" reißen die Spice Girls einem Obdachlosen lachend den Hut vom Kopf, bevor sie eine Upper-Class-Party entern. Damals galt das als heiterer Mädelswitz, nicht als widerlicher Klassismus. Im Nationalstolz der Spice Girls bahnt sich schon an, was dann die Nullerjahre entscheidend prägen wird: Der Wunsch, zu vertrauten, festen, nicht im Zeichengestöber auflösbaren Identitäten zurückzukehren. Die Spice Girls feierten ihre britische Identität, die 1989 verkündete Fatwa gegen Salman Rushdie brachte britische Muslime dazu, sich nun vor allem über ihre wie auch immer geartete islamische Identität zu definieren. Wir erleben in den 90ern trotz der scheinbar prägenden Freiheit also die Rückkehr der Nationalismen und der metaphysischen Dogmensysteme.
Zwei weltpolitische Ereignisse bilden die Klammer Ihres Buches: der Fall der Berliner Mauer und der Anschlag auf das World Trade Center. Was ist mit dem Freiheitsversprechen vom November 1989 derart schiefgelaufen?
Balzer: Rückblickend war die Idee von einem Ende der Geschichte, die der US-Soziologe Francis Fukuyama formuliert hatte, aus einer sehr engen Perspektive gefasst. Die Freiheit, an die man glaubte, als im Osten einige Grenzen fielen, war insofern eine Chimäre, als in der Folge viele andere neue Grenzen gezogen wurden. Die Euphorie über den Mauerfall dauerte in Berlin gerade einmal zehn Tage, dann begannen die Westdeutschen sich schon belästigt zu fühlen von den armen Verwandten in den komischen Jeans und mit den sonderbaren Frisuren. Bald darauf folgten die sehr komplizierten Jugoslawienkriege mit der längst überwunden geglaubten Teilung in ethnische Kategorien. Der Wunsch, sich bestimmten Identitäten zuzuordnen, rührt immer auch von einem Wohlstandsgefälle her, das etwa in Deutschland zwischen Ost und West bis heute nicht behoben ist.
Der Popkultur fällt das Überwinden der Grenzen ungleich leichter.
Balzer: Speziell Techno wurde gerade auch im Osten als ein großes Freiheitsversprechen wahrgenommen. Einer der größten Open-Air-Raves der Dekade fand auf der Krim statt. Gleichzeitig griff im Osten und in jenem Teil der Welt, den wir heute als "globalen Süden" bezeichnen, das Narrativ eines dekadenten, gottlosen, chaotischen Westens um sich. Jene Erzählung also, die heute nicht nur die Islamisten prägt, sondern auch Putin und die zugehörige Ideologie. Man dachte, mit dem westlichen Liberalismus käme auch die Demokratie über die ganze Welt, begleitet vom Internet, das die Archive öffnet und das Wissen sowie die Kommunikation befreit. Aber viele Menschen identifizieren sich offenbar weit lieber mit Herkunft und Tradition, als Freiheit und universelle Vernetzung zu genießen. Davon ganz zu schweigen, dass das Internet inzwischen vielfach zur perfekten Überwachungsmaschinerie geworden ist. Dem genauen Gegenteil dessen also, was seine Erfinder einst im Sinn hatten.
Welche Weichen hätten damals anders gestellt werden müssen, damit die Welt heute als Ganzes besser dastünde?
Balzer: Diese Frage ist falsch gestellt, weil sie von der Existenz eines globalen Akteurs ausgeht, dem diese Weichenstellung möglich gewesen wäre. Man glaubte, dass sich die Menschheit mit dem Ende des Kalten Krieges darauf besinnt, dass alle das Gleiche wollen: Freiheit, Demokratie, liberalen Kapitalismus. Das ist aber nicht der Fall. In den 90ern haben sich erstmals jene Konflikte abgezeichnet, die daraus resultieren, dass in einem globalen Maßstab nicht alle das Gleiche wollen. Eine zentrale Weichenstellung zum Besseren wäre damals aber tatsächlich möglich gewesen.
In der globalen Klimapolitik?
Balzer: Genau. Bereits 1989 schrieb die New York Times groß über einen Nasa-Forscher, der die Entwicklung des Klimas berechnete und Alarm schlug, auch erste Klimakonferenzen gab es. Die Daten sagten ganz klar, dass der Weg in die Katastrophe führt, wenn wir nicht sofort gegensteuern. Doch das Gegenteil geschah: Die Autos wurden immer größer, der SUV avancierte infolge des Kinohits "Jurassic Park" zum beliebtesten Fetischobjekt der 90er, der Billigflugtourismus explodierte. Die turbokapitalistische Elite hat da in Sachen Ressourcen-und Energieverschwendung noch einmal richtig Gas gegeben. Und die Leute hatten einfach keinen Bock mehr auf die Katastrophenstimmung der 80er. Das ist die dunkle Seite der Freiheit: Alle drücken noch einmal so richtig auf die Tube.
Was hat Steven Spielbergs Dinosaurierfilm mit dem Boom der SUVs zu tun?
Balzer: In dem Film fahren die Forschergruppen und die Besucher in einem Ford Explorer durch den Jurassic Park. Dieses Auto ist derart groß und kräftig, dass selbst Dinosaurier Schwierigkeiten haben, ihre Zähne durchzuschlagen. Das Modellauto wurde zum beliebtesten Merchandise-Artikel des Films. In weiterer Folge legten sich ganz viele Mittelschichtsfamilien der westlichen Welt derartige Vehikel auch in echt zu. Autos mussten in den 90ern sowieso immer größer und panzerartiger anstatt ressourcenschonender werden. Allen voran der Hummer, ein Militärfahrzeug im Irakkrieg, das Arnold Schwarzenegger auch für die zivile Nutzung popularisiert hat.
Das Internet ließ die Welt zum globalen Dorf werden. Warum ist sie trotzdem nicht näher zusammengerückt?
Balzer: Wie jedes Medium ist auch das Internet inhaltlich nach allen Seiten offen. Es unterstützt Emanzipation und ist zugleich ein Ort der Desinformation und des Hasses. In den 90ern war noch nicht abzusehen, was daraus wird, erst lachhaft wenige deutsche Haushalte waren überhaupt online. AOL hatte damals einen Werbespot mit dem Tennisidol Boris Becker. Er ist ganz überrascht davon, wie einfach man reinkommt in dieses Internet. Ganz schnell war aber klar, dass die Freiheit, die vom Internet und seinem Open-Source-Gedanken anfangs ausging, zuallererst wieder nur eine Freiheit der Kapitalvermehrung ist. Ende der 90er kommen auch die ersten Cookies auf. Sie werden zur Grundlage der Suchmaschinenoptimierung. Das sorgt für Zeitersparnis, macht aber jeden Internetnutzer zum gläsernen Menschen.
In den 80ern wurde noch gegen die Volkszählung demonstriert, die als Symbol eines Überwachungsstaates galt.
Balzer: Als Teenager war ich da auch dabei. Der gläserne Mensch war eine Dystopie, dabei ging es bei der Volkszählung nur darum, eine Handvoll Dinge anzukreuzen. Also nichts im Vergleich dazu, was heute jeder in drei Minuten auf Instagram und Facebook preisgibt. Schon interessant, wie schnell so eine kritische Opposition in eine völlige Kapitulation kippen kann.
Wie lautet Ihre Erklärung dafür?
Balzer: Man hat sich einfach daran gewöhnt. Und vor allem wurde das Netz zu einem entscheidenden Teil der eigenen Individualisierung. In den 90ern wollten alle möglichst speziell sein, am liebsten Außenseiter und Freaks, daher auch der Boom von Tattoos, Piercings und plastischer Chirurgie. Im Internet ist die ersehnte Einzigartigkeit zur Wirklichkeit geworden. Dass man dabei auch absolut transparent ist, wird als Grundlage des Daseins mit in Kauf genommen.
Ich hätte noch einige Entscheidungsfragen zu den Nineties. Techno oder Hip-Hop?
Balzer: Techno, weil es sowohl in musikalischer wie auch in politisch-emanzipatorischer Hinsicht die interessanteste Musik war. Hip-Hop hatte seine große Zeit als innovative Musik in den 80ern.
Flanellhemd oder Trainingsjacke?
Balzer: Auch ich habe damals kurz einmal Karohemd und Ziegenbart getragen, die Trainingsjacke hat sich auf Dauer aber als ungleich haltbarer erwiesen.
Joschka Fischer oder Helmut Kohl?
Balzer: Für die 90er Helmut Kohl. Bei der Wiedervereinigung ist zwar viel schiefgelaufen, letztlich darf man die historische Größe aber nicht übersehen, die Kohl darin hatte, den Prozess der Wiedervereinigung mit der europäischen Einigung zusammenzuführen. Kohl als Europäer wird von uns Linken gerne kleingeredet.
Filterkaffee oder Caff è Latte?
Balzer: Ich verachte Menschen, die sich Milch in den Kaffee kippen, zutiefst. Sich mit Milchschaum Muster in den Kaffee zu malen ist die lächerlichste Form der Individualisierung überhaupt. Seit ich Kaffee trinke, trinke ich Filterkaffee. Inzwischen bin ich damit zum dritten Mal in irgendwelchen Revivalschlaufen ganz vorne mit dabei.
Anruf oder SMS?
Balzer: Damals Anruf. In den 90ern war man noch nicht permanent online und hat daher nachts stundenlang mit Freundinnen und Freunden telefoniert, bis das Ohr glühte. Um dann aber auch wieder eine Weile nicht zu telefonieren. Die Zeit des endlosen Telefonats war auch die Zeit, in der Kommunikation noch etwas Besonderes darstellte. Nachrichten schickt man ständig, während ein langes Telefonat ein besonderes Zeichen der Verbundenheit war.
"Matrix" oder "Jurassic Park"?
Balzer: In "Matrix" steckt alles, was man über das Ende der 90er wissen muss. Über den letzten Höhepunkt des postmodernen Denkens also, aber auch den Übergang dieses Denkens in eine Technologie, die die Menschen befreite und zugleich auch in die Angst vor der Versklavung stürzte. Eine absolut berechtigte Angst übrigens.
"Baywatch" oder "Twin Peaks"?
Balzer: "Emergency Room!"
Warum?
Balzer: "Baywatch" war mir zu krass in seiner Stumpfheit, "Twin Peaks" auf Dauer zu ambitioniert. Bei "Emergency Room" hingegen habe ich von 1994 bis 2009 keine einzige Folge verpasst. Die ersten Staffeln fand ich ästhetisch höchst interessant - die Kamerafahrten, die Musik, all das Technische. Und dann hatte ich mich einfach derart ins Personal verliebt, dass ich bis zum bitteren Ende weiterschauen musste.
Sie haben nun Bücher über die 70er, 80er und 90er geschrieben. Folgt als Nächstes eine Analyse der Nullerjahre?
Balzer: Um sich einen Reim auf diese Ära zu machen, braucht man noch ein bisschen Abstand. Der Zeitraum liegt aber auf der Hand: Die Nullerjahre dauern von 9/11 bis zum Lehman-Brothers-Bankencrash 2008. Im Unterschied zu den 90ern wären sie also ein sehr kurzes Jahrzehnt, da könnte man einmal ein etwas dünneres Büchlein schreiben. Die wirtschaftliche Entwicklung ist allerdings sehr komplex, ebenso die Frage, wie es nach Irakkrieg, Guantánamo & Co um den liberalen Führungsanspruch des Westens bestellt ist. Anders als bei der Auseinandersetzung mit den 90ern weiß ich bei den Nullerjahren schon vorher, dass es unerfreulich wird.