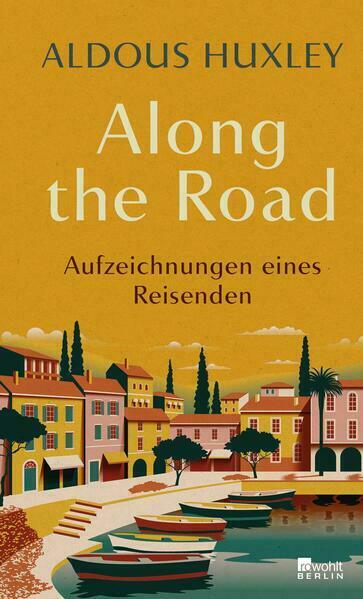Das Gespür guter Maler für Pobacken
Juliane Fischer in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 37)
Touristen sind im Allgemeinen ein recht trübseliger Haufen“, befindet Aldous Huxley. „Wenn sie eine flüchtige Stunde lang so tun können, als wären sie zu Hause, wirken die meisten Touristen tatsächlich glücklich“, schreibt der Autor (1894–1963), der später durch seine hellsichtige Dystopie „Brave New World“ („Schöne neue Welt“) berühmt werden sollte. Im Kapitel „Warum nicht lieber zu Hause bleiben?“ zieht er über den Massentourismus her, klappert aber selbst genauso die Sehenswürdigkeiten ab – am Beifahrersitz eines 10-PS-Citroën. (Wobei: „Ob ein Citroën mit zehn PS wirklich als Auto gelten kann, ist noch die Frage.“ Für ihn spreche vor allem, „dass er fährt“.) In den nerdigen Beobachtungen, die Huxley „Along the Road“ ersonnen hat, würden „sich Witz und Ernst aufs Schönste verbinden“, urteilte die New York Times 1925.
Erst jetzt, fast 100 Jahre später, hat der Autor und Journalist Willi Winkler das Buch erstmals ins Deutsche übersetzt. Der gebürtige Brite Huxley schreibt darin über seine Reisen durch das Europa der 1920er-Jahre, durch bildhafte Landschaften in Holland und Belgien und ganz besonders oft durch Italien, wo auch „Brave New World“ entstanden ist. Und er denkt über das Unterwegssein selber nach.
Zum Beispiel über „Bücher für die Reise“. Der erschöpfte Tourist sei zu längerer Konzentration ohnehin nicht fähig, daher dürfe die Lektüre ruhig der reinen Neugier dienen und „den Geist kitzeln“. Für Huxley hieß das zum Beispiel: wahllos in einem Lexikon zu schmökern; das unterscheidet ihn dann doch von durchschnittlichen Reisenden seiner Zeit. Er liest die Encyclopædia Britannica anstatt den Reiseführer von Baedeker: Dieser preise indifferenziert alles, was alt ist. Statt der „langweiligen, dummen Fakten, die jeder parat hat“, solle man sich lieber auf „Ungewöhnliches und Abseitiges“ konzentrieren, auf die No Names und Fun Facts, das „Abgelegene und Seltsame“ anstatt des „Naheliegenden und Klassischen“.
Seine Umwege geraten ausschweifend. Das Unterwegssein spornt ihn an, über alles Mögliche zu sinnieren – über Neid, Lügen, die Kunstform Theater. Mit seiner Verachtung für Massengeschmack und Kommerzialisierung klingt Huxley streckenweise wie der Philosoph Theodor Adorno.
Er kennt sich mit griechischen Säulenordnungen und dem Schicksal italienischer Adelsfamilien aus, schwärmt für den römischen Architekten Leon Battista Alberti und für Pieter Bruegel den Älteren, dessen Werk man doch bitte im Kunsthistorischen Museum Wien bestaunen möge. Allen guten Malern gemein sei übrigens ihr „Gespür für Pobacken“. Gerne wäre Huxley selbst bildender Künstler geworden, seine Sehschwäche machte das unmöglich. Also malte er mit Worten die herbstliche Landschaft in Holland und ließ das Pferderennen in Siena als Tableau vivant erscheinen.
„Along the Road“ fand sogar Eingang in die Weltgeschichte, wie man im Nachwort erfährt. Für Huxley war das Fresko im Rathaus von Sansepolcro, das die Auferstehung Christi zeigt, „das beste Bild der Welt“. 1944 war der britische Offizier Anthony Clarke mit der Beschießung von Sansepolcro beauftragt. Doch er hatte als Teenager Huxleys Buch gelesen, erinnerte sich des Bildes – und gab nicht den erwarteten Feuerbefehl.