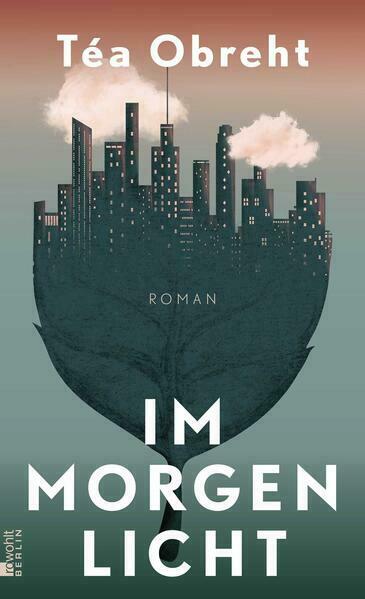Hunde aus Ruß und Stahlwolle
Thomas Edlinger in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 21)
Der titelgebende Wolkenkratzer Morgenlicht in Téa Obrehts neuem Roman ist ziemlich heruntergekommen. Gebaut wurde er vor „über hundert Jahren“, als Vorzeigeprojekt des noblen Stadtteils mit dem martialischen Namen Battle Hill. Nun versinkt das Hochhaus im gelockerten Untergrund, die Aufzüge und die Stromversorgung fallen immer wieder aus.
In dem maroden Gebäude in Island City, das an ein von Überflutungen, Hitze und Versorgungsengpässen geplagtes Manhattan denken lässt, leben neben Ortsansässigen und Flüchtlingen die elfjährige Icherzählerin Silvia, ihre Mutter und ihre Tante Ena. Sie sind Teil eines Wiederansiedlungsprogramms. Die verantwortlichen Regierenden belässt die 1985 in Belgrad geborene und 1997 in die USA emigrierte Autorin freilich im Dunkeln – wie so vieles in ihrer Dystopie.
In dieser sanft chaotischen und von trügerischen Hoffnungen genährten Welt von morgen gibt es aber immerhin ein „Landesbüro für Nachwelt“, das sich um die Organisation des Wiederaufbaus nach einem offenbar verheerenden Krieg kümmern soll. Außerdem existiert eine Schule, ein Radio spendet Trost und Rat und die Müllentsorgung funktioniert so leidlich. Silvias Mutter träumt gar von der Übernahme eines Cafés in näherer Zukunft. In diesem eher dauerimprovisierten als apokalyptischen Climate-Fiction-Szenario geht also nicht alles unter, sondern alles irgendwie weiter.
Das einsame Mädchen Silvia rekapituliert, wie man aus einer knapp gehaltenen erzählerischen Klammer erfährt,16 Jahre später die Ereignisse von damals. Das Verhältnis zu ihrer Mutter, die einen Sommer auch als Hufauskratzerin gearbeitet hat, erscheint in diesem Rückblick zunächst als unterkühlt und distanziert, während die als Hausmeisterin arbeitende Tante den Teenager mit ihrer Fabulierkunst in den Bann zieht. Ena erzählt nämlich von einem durch Zeit und Raum wandernden Berggeist, der schon in der sogenannten Alten Heimat sein Unwesen getrieben habe und auch im Hier und Jetzt noch über unglaubliche magische Kräfte verfügen soll: Die drei riesigen Hunde, erschaffen wie „aus Ruß und Stahlwolle“, die von einer mysteriösen, im Penthouse wohnenden Malerin nach Einbruch der Dunkelheit ausgeführt werden, seien nur nachts Hunde. Tagsüber aber verwandelten sie sich in Menschen.
Bevor die Protagonistin Näheres zu diesen möglicherweise als Anspielung auf slawische Mythologien am Balkan konzipierten Geistererscheinungen in Erfahrung bringen kann, verstirbt Ena auf bizarre Weise beim Zubinden ihrer Schuhe. Silvia, die von ihrer danach als Hausmeisterin-Ersatz und später als Wracktaucherin schuftenden Mutter zur Geheimniskrämerei über ihre Herkunft und die Kenntnis ihrer Muttersprache namens Unser angehalten wird, ist in ihrer unbändigen Neugier auf sich allein gestellt und beginnt mit ihren detektivischen Nachforschungen zu der einzelgängerisch im Dachgeschoß hausenden Bezi Duras. Dabei vertraut sie auf den Schutzzauber angeblich magischer Objekte und läuft Gefahr, nicht mehr zwischen verbindlichen Wahrnehmungen und wirksamen Einbildungen unterscheiden zu können.
Die Frage nach der Wirklichkeit des Fiktionalen stellt sich auch in einem Handlungsstrang, der von biografischen Aneignungen und der Suche nach einem verlorenen Manuskript handelt. Später begegnet Silvia, das bislang einzige Kind im Hochhaus, der fast gleichaltrigen Mila. Diese wird zu einer Verbündeten, deren furchtlose Verwegenheit in Kontrast zur Vorsicht Silvias steht. Bezi Duras aber entpuppt sich – eine weitere der zahlreichen Wendungen in diesem täuschungsfreudigen Roman – als durchaus diesseitig engagierte Erscheinung. Sie arbeitet an desillusionierenden Recherchen über jene in weiten Teilen unbewohnbare und vergiftete Insel, die von der Regierung als neuer Siedlungsraum in Aussicht gestellt wird. Auch Silvias Mutter bekommt die Spätfolgen des ökologischen Desasters zu spüren, als während eines Tauchgangs in den Ruinen eines Hotels plötzlich eine Wand einstürzt und das Schicksal der Taucherin an einem seidenen Faden hängt.
In der Folge wendet sich Obreht, die sich in ihrem letzten Roman „Herzland“ um eine Neudeutung des Western-Genres aus osteuropäisch-postkolonialer Sicht bemüht hatte, nochmals intensiv dem konfliktreichen Verhältnis von Mutter und Tochter zu, das vor dem Hintergrund eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens nochmals an Brisanz gewinnt. Es gelingen ihr hier einige überzeugende Passagen über gelingendes und scheiterndes Einander-Verstehen. Darüber hinaus relativiert sie auch die Tendenz des eigenen Romans zur Wiederverzauberung der nachmodernen Welt, wenn sie etwa der Mutter als Reaktion auf den Aberglauben ihrer Tochter in den Mund legt, diese solle sich gefälligst von dem „volkstümlichen Quatsch“ befreien.
In Bezug auf das offenbar im Rahmen von nicht näher definierten „Säuberungen“ verübte Kriegsverbrechen bleibt eine genaue politische Verortung aus. Diese Abstraktion von politischer Gewalt und kriegerischem Horror kann man dem Roman angesichts der realen Kriege und der flexiblen Faschismen, die sich an vielen Orten der Welt manifestieren, durchaus zum Vorwurf machen. Die Last einer ins Unbestimmbare gerückten Geschichte liegt nicht so schwer auf den Schultern wie eine konkrete Erinnerung. Trotz aller Traumata ist es der Protagonistin daher auch möglich, sich selbst ins Zukunftsoffene zu entwerfen, kann Obreht am Schluss noch einmal den narrativen Köder der „Was wäre, wenn“-Fiktionen auswerfen: „Die Vergangenheit ist ungeheuerlich. Nur bedeutet sie weniger und weniger. Also kommen wir ohne sie zurecht. Und das ist gut so.“