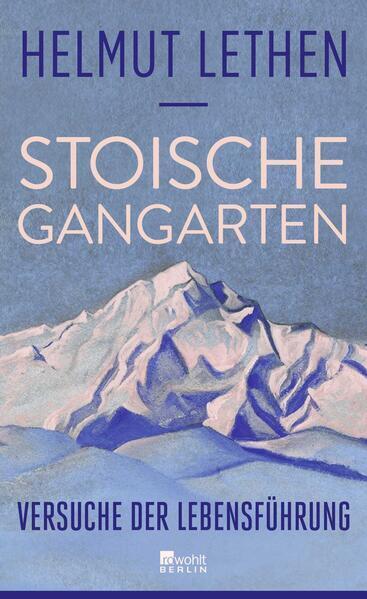"Die Parolen der Wehrtüchtigkeit kommen nicht an"
Matthias Dusini in FALTER 37/2025 vom 10.09.2025 (S. 30)
Wo will ein Autor ein Gespräch führen, der die Avantgarde der 1920er-Jahre erforschte? Im Café Weimar in der Währinger Straße. Literaturwissenschaftler Helmut Lethen, 86, dessen bahnbrechende Studie "Verhaltenslehren der Kälte" sich der Weimarer Republik widmete, wählt den Ort auch aus pragmatischen Gründen. In Währing wohnend, ist der seit seiner Jugend begeisterte Sportler inzwischen auf eine Gehhilfe angewiesen.
Lethen hat eine Vergangenheit als Maoist, ein Irrtum, den er in seinen Erinnerungen "Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug" (2020) aufarbeitete. Seine Ehe mit der Philosophin Caroline Sommerfeld, Aktivistin der Identitären Bewegung, sorgte für Schlagzeilen. Die Geschichte vom alten Ex-Linken und der jungen Rechten schlug in der New York Times auf und war heuer sogar Thema einer Festwochenproduktion.
Mit geistreichen, unterhaltsamen Reflexionen schrieb sich Lethen, der von 2007 bis 2016 in Wien das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften leitete, in die erste Liga deutschsprachiger Essayisten. Sein neues Buch widmet sich den Lehren der antiken Stoa. Lethen fragt, wie sich in einer Ära der politischen Unversöhnlichkeit eine Mitte finden lässt. Das Falter-Gespräch konzentriert sich auf ein Thema, das polarisiert: den Krieg. Wie blickt jemand, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, auf das Sterben in der Ukraine und die Forderung nach Aufrüstung?
Seit unserem letzten Treffen 2018 ist Lethens Stimme leiser geworden. Im Mai 2022 hatte er einen Schlaganfall, der zum Glück keine bleibenden Schäden hinterließ. Man merkt Lethen das Glück an, das er über die Genesung empfindet, seine Freude am Lesen und Exzerpieren. Das nächste Buch ist bereits in Planung. "Ich kann schreiben", bemerkt er mit einem Lächeln.
Herr Lethen, einige alte Linke sind dagegen. Sind Sie für eine militärische Unterstützung der Ukraine?
Helmut Lethen: Wir müssen vermeiden, den Kult der Wehrlosigkeit als Tugend der Intellektuellen zu begreifen. Davon will ich mich absetzen. Gleichzeitig halte ich das Argument für richtig, dass die Verhandlungen für einen Frieden nur auf dem Weg der Stärke zustande kommen können. Insofern bin ich für den Freiheitskampf der Ukrainer. Mein neues Buch ist allerdings ein Plädoyer für Diplomatie.
Warum? Lethen: Meine einzige Hoffnung ist, Diplomaten zu finden, denen es gelingt, ihre Empörung auf Eis zu legen, um in der Hitze der kriegerischen Konflikte eine realistische Mitte zu finden, die von selbst nicht vorhanden ist.
Wir identifizieren uns mit der Ukraine. Gleichzeitig wäre kaum ein Österreicher bereit, für das eigene Land zu sterben. Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus?
Lethen: Ich gebe diesen Kampagnen für Wehrertüchtigung, wie sie in Deutschland gemacht werden, wenig Chancen. Im Augenblick sind 40 Prozent gegen die Wehrpflicht. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler sagt, Heroismus bedürfe der Opferbereitschaft. Und ich entdecke in unserer Gesellschaft überhaupt kein Element von Opferbereitschaft.
Dafür wächst die Rüstungsindustrie.
Lethen: Ich war erstaunt, als ich gehört habe, dass mein Lieblingsfußballverein Borussia Dortmund einen Sponsorenvertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall hat. Zur gleichen Zeit wurde eine demografische Studie über das Problem der Einsamkeit veröffentlicht. Das Ineinandergreifen dieser beiden Faktoren finde ich unglaublich interessant und widme ihm das Schlusskapitel unter dem Titel "Einsamkeit und Rheinmetall". Wenn das wirklich stimmt mit der Einsamkeit, wie kann dann der Kollektivismus einer heroischen Haltung je auf diese einsamen Körper übertragen werden? Die Parolen der Wehrtüchtigkeit kommen nicht an.
Eine Frage, die Ihre Generation, die 68er-Generation, gern ihren eigenen Vätern gestellt hat: Was hast du im Zweiten Weltkrieg gemacht? Lethen: Ich bin im Januar 1939 geboren und habe den Krieg vor allem an Evakuierungsorten verbracht. Wir wohnten in Mönchengladbach und wurden zuerst nach Jünkerath in der Eifel evakuiert. Und da erinnere ich mich noch, dass ich mit meiner Mutter über die Dorfstraße ging und die Mutter nach oben zeigte und sagte: "Das ist die V2, die wird uns erlösen."
Sie meinen die von NS-Ingenieuren entwickelte "Wunderwaffe".
Lethen: Genau. Als ich die Geschichte später einmal dem technisch versierten Kollegen Friedrich Kittler erzählte, fragte er: "Wann war das?" Die Raketenabschussstation sei 20 Kilometer von Jünkerath entfernt gewesen. Kittler wusste auch, in welchem Neigungswinkel die Rakete abgeschossen worden war und dass sie in den Ärmelkanal gestürzt sei. Gut, als Kind hatte ich natürlich nichts mit der Technologie von Raketen zu tun. Wir wechselten dann nach Oberwesel, wo ich das Ende des Krieges intensiv erlebte.
Welche Erlebnisse waren das?
Lethen: An einer Badestelle wurden wir von einem amerikanischen Tiefflieger angegriffen. Als Kind erinnerte ich mich ganz genau: Der Tiefflieger hielt über unserer Badestelle, öffnete eine Luke, schaute hinunter und warf Bomben nach uns. Unsere Mutter schmiss uns Kinder in ein Brennnesselfeld, um uns zu retten. Heute weiß ich: Das war ein Tagtraum. Dass ein Flieger anhalten kann, war schlicht unmöglich. Der Traum kam daher, dass uns gesagt wurde, die Piloten würden die pflügenden Bauern vom Feld schießen.
Welche anderen Erlebnisse haben sich eingeprägt?
Lethen: Ich erinnere mich an einen völlig abgerissenen Trupp deutscher Wehrmachtssoldaten, der durch das Flusstal zog. Frauen aus dem Dorf begleiteten sie, sie hatten Mitleid und gaben ihnen Brot. Und dann kamen die haushohen Amphibienpanzer der Amerikaner, und die Straßen des Winzerdorfs Oberwesel verfinsterten sich. Und dann waren die Sieger da. Die lächelnden GIs. Mutter machte ihnen die Wäsche und war völlig erstaunt, dass die Haut der schwarzen GIs nicht abfärbte. Und so hatten wir unsere erste Aufklärung.
Wie haben sich die gefürchteten Amerikaner verhalten?
Lethen: Eines Tages wurden vor dem kleinen Hotel, in dem wir untergebracht waren, zwei Deutsche, die Widerstand geleistet hatten, an die Wand gestellt. Wir durften nicht durch die Vorhänge gucken, aber ein alter Nazi, der das gesehen hat, erwartete schreckliche Sachen. Aber es passierte nur eine Leibesvisitation.
An welche schrecklichen Dinge erinnern Sie sich? Lethen: Kinder einer befreundeten Familie erstickten in Luftschutzkellern.
Wie ging es nach dem Kriegsende weiter? Lethen: Mein Vater kam aus britischer Kriegsgefangenschaft zurück. Meine Mutter hatte einen Liebhaber, aber das hat den Familienfrieden kaum gestört. Mein Vater war nach einer Denunziation bereits im September 1939 eingezogen worden. Er war ein vollkommen unbekannter Mann für uns, als er heimkehrte. Er brachte eine Büchse Kakao mit und klagte darüber, dass sie in der britischen Gefangenschaft fast täglich Hammelfleisch essen mussten, während wir gar kein Fleisch hatten.
Entschuldigen Sie die Frage, aber wer war der Liebhaber Ihrer Mutter? Lethen: Der beste Freund meines Vaters. Ein Angestellter der Deutschen Bank, der "UK", also unabkömmlich gestellt war und nicht in den Krieg musste.
Was waren diese Heimkehrer im Allgemeinen für Männer?
Lethen: Sie kamen mit einer Niederlage zurück. Kein Mensch hat ihnen für irgendetwas gedankt. Sie hatten keinen Resonanzraum, kein Medium, keine Öffentlichkeit. Das erste Mal über Kriegs-und Tötungserfahrungen im Krieg gesprochen wurde dann ausgerechnet in den Landser-Heften. Der Landser war eine seit den 1950er-Jahren erscheinende populäre Reihe, in der die Grenzen des offiziell Sagbaren der Fronterfahrungen als Erfahrungen einer Schicksalsgemeinschaft kleiner militärischer Kohorten ehrenwerter Männer durchgespielt wurden. Die Hefte hatten ganz offensichtlich eine integrative Wirkung.
Es gab auch eine Flut von Wehrmachtsliteratur, die den einfachen deutschen Soldaten glorifizierte, etwa Hans Hellmut Kirsts Trilogie "08/15".
Lethen: Da vollzog sich eine interessante Aufspaltung. Auf der einen Seite gab es eine verbrecherische Führungselite, auf der anderen Seite exzellente Krieger, die ihr Handwerk verstanden und ihr Leben für Deutschland opferten. Beide hatten vermutlich nichts miteinander zu tun. Kirsts Roman "08/15" und seine Verfilmung wurden von allen Schichten der Gesellschaft akzeptiert, denn es war die Ehrenrettung einer sauberen Wehrmacht gegenüber einer korrupten Führung. Die Spaltung in diese zwei Sphären hielt sich bis zur Wehrmachtsausstellung in den 1990ern. Da wurde plötzlich klar, dass die Verbrechen des Vernichtungskrieges im Osten weit in die Wehrmacht hineinreichten.
War das vielleicht für Kinder eine Art von Entlastung, weil sie die Väter als tapfere Soldaten sehen konnten? Lethen: Komischerweise betrachteten wir die Väter überhaupt nicht als tapfere Soldaten. Es gab keine stolzen Väter.
Das demokratische Deutschland musste eine Armee aufbauen. Was für ein Soldatenbild entwarf die BRD?
Lethen: Der Soldat wurde im Zuge der Wiederbewaffnung umgemünzt in den Bürger in Uniform. General Graf Wolf von Baudissin war am Aufbau der Bundeswehr maßgeblich beteiligt. Er hat das Bild vom Soldaten als Sozialarbeiter in Uniform geprägt: die Armee als Kopie der demokratischen Gesellschaft. Das Debakel der bis heute nicht sehr wehrtüchtigen Bundeswehr hat da einen seiner Ursprünge.
War die Bundeswehr also die Antithese zur stets kriegsbereiten US-Armee?
Lethen: 2003 habe ich einen Artikel der Historikerin Ute Frevert gelesen, der mich schockiert hat. Sie kam damals von einer Gastprofessur in Amerika zurück und war mit der pazifistischen Außenpolitik der Bundesrepublik konfrontiert. Sie reagierte zornig und sagte: Ja, diese Bundesrepublik hat sich immer im Habitus der Ohnmacht gefallen, ist aber nichts als der jammernde Zahlmeister amerikanischer Militärinterventionen gewesen. Nach außen hin demonstrierte sie einen moralischen Habitus, trug aber Militärinterventionen der USA mit. Diese Erkenntnis war mir ferngeblieben.
Warum waren Sie schockiert?
Lethen: Weil ich diese indirekte Beteiligung der Bundesrepublik als ökonomischen Stützpfeilers einer Kriegspolitik, die wir abgelehnt haben, nie gesehen hatte. Marta Kos Marko, das ist die slowenische EU-Kommissarin für Erweiterung, sagte unlängst in einem Artikel, das Ziel der Europäischen Union sei es, die Ukraine zum Industriezentrum Europas zu machen. Unternehmen würden weltweit auf der Lauer liegen. Da dachte ich, wenn ein tapferer Soldat der Verteidigung der Ukraine das liest, dann muss der doch sofort die Waffe aus der Hand fallen lassen. Sterbe ich für Investoren?
Sie schreiben über stoische Gangarten. Was ist Stoa überhaupt? Lethen: Der Stoiker ist in meinen Augen ein politischer Pragmatiker. Er hofft nicht, sagt der römische Philosoph Epiktet. Das ist wichtig. Er schließt keinen Pakt mit der Zeit, mit der Zukunft, sondern konzentriert seine ganze Aufmerksamkeit auf die Gegenwart. Daher ist er nicht anfällig für Utopien.
Hat der Stoiker eine gute Presse?
Lethen: Zum Stoizismus ist viel auf dem Markt. Meistens preist man ihn als Lehre, die für die Tugend der Gelassenheit eintritt. Er hat eine gute Presse und eine schlechte Praxis, würde ich sagen.
Warum? Lethen: Ich sehe nirgendwo, dass die Gelassenheit des Stoikers politisch umgesetzt wird. Dazu würde gehören, die Fronten genauer wahrzunehmen. Zu überlegen, welche Elemente der Wahrheit auch beim Gegner vorhanden sind. Wie können wir damit umgehen? Also alles, was eigentlich einen guten Diplomaten ausmacht. Das vermisse ich.
Sie gehörten zum politischen Flügel der deutschen 1968er-Bewegung, die für ihre Militanz bekannt war. Woher kam diese Gewaltbereitschaft?
Lethen: Die Militanz galt Avataren in fernen Ländern, sei es die Black-Panther-Bewegung in den USA, seien es verschiedene aufständische Truppen in Afrika oder Palästina. Die Einzigen, die da eine Ausnahme machten, waren natürlich die Leute der Roten Armee Fraktion. Für uns in den maoistischen Parteien war die RAF die Jeunesse dorée, die Elitetruppe der Bourgeoisie, die völlig durchgeknallt war.
Sie haben im Rahmen der Studentenproteste mit Genossen das Berliner Institut des Literaturwissenschaftlers Peter Szondi verwüstet. War das nicht auch militant? Lethen: Das ist wirklich eine der beschämendsten Aktionen, die ich in meinem politischen Leben verbrochen habe. Die Aktion kam aus dem kleinbürgerlichen Neid auf eine Bildungselite, die sich mit den Problemen der Massenuniversität nicht abgeben wollte. Es traf den Falschen. Szondi war ein zu Herzen gehender Demokrat. Er kannte die Namen derer, die das Institut zerstört haben, hat sich aber geweigert, sie an die Polizei weiterzuleiten. Er hat sogar alle geschützt, die hinausgeschmissen werden sollten, und gesagt: Bei mir könnt ihr weiterstudieren. Mich hat er für eine Professur in Bremen vorgeschlagen. Das ist ein Großmut, das hält man nicht aus.
Von den Wahrheiten des Kommunismus haben Sie sich 1994 in Ihrem wichtigsten Buch "Verhaltenslehren der Kälte" verabschiedet. Richtete sich Ihr Buch in der Hochzeit sogenannter Gutmenschen gegen den Wärmekult der Friedens-und Ökobewegung?
Lethen: "Die Verhaltenslehren der Kälte" waren eine Art Taschen-Machiavelli für den Hausgebrauch. Diese Betrachtungen hatten keinen Gegner innerhalb der Linken mehr, sondern waren fast wie Vorschläge einer Paartherapie. Offiziell ging es um die, wie der US-Soziologe Richard Sennett sagen würde, "Tyrannei der Intimität" und die Betroffenheitskultur. Davon wollte ich mich freischwimmen.
Wie entstand das Buch?
Lethen: 1977 zog ich die Uniform eines maoistischen Kaders aus, die ohnehin nur staatliche Behörden ernst genommen hatten, und ging mit der Familie in die Niederlande. Das Buch schrieb ich in einer kleinen Plattenbausiedlung zwischen Utrecht und Amsterdam, hatte eigentlich kaum noch Verbindung mit Berlin. Ich war Hauptdozent an der Universität Utrecht. Da ging es uns sehr gut.
Sie schrieben über die heute weit verbreitete Vulnerabilität. Steht diese Verletzlichkeit einem wieder gefragten militärischen Heroismus im Wege?
Lethen: Die Kultur der Vulnerabilität war eine Errungenschaft der Nachkriegsgesellschaft. Sie ist eine popkulturelle Leistung, weil sie die Massen ergreift. Es gibt auch heute in Arenen Riesenansammlungen mit zehntausenden begeisterten Menschen, die Billie Eilish oder Lady Gaga zujubeln. Diese Massenevents sind mir lieber als die heroische Kriegsnähe monotheistischer Kulturen, weil sie näher zum Markt, aber auch näher zum Frieden sind. Es sind großartige Zeichen von Augenblicksgöttinnen, fernab ideologischer Kirchen, die wir aus der Tradition kennen.
Am Ende unseres Gesprächs möchte ich Ihnen eine persönliche Frage stellen. Seit Ihrer Jugend waren Sie ein begeisterter Sportler. Vermissen Sie den Radsport? Lethen: Sehr. Radfahren gehört zu meinen Glücksgefühlen. Leider ist mir das nach meinem Sturz vor zwei Jahren verboten worden.
Was ist der Reiz der Tour de France?
Lethen: 180 Fahrer in einem Peloton zu sehen, wie die Hauptgruppe der Tour de France genannt wird. Die Geräusche der Kugellager zu hören, die an einem vorbeirauschen. Die Strategien zu beobachten, mit denen die favorisierten Sprinter von ihren Mannschaften nach 200 Kilometern so in Position gebracht werden, dass sie Chancen haben, den Sprint zu gewinnen. Wenn das etwas Militärisches ist, dann ist es der letzte Zug des Militarismus, den ich mir erlaube.