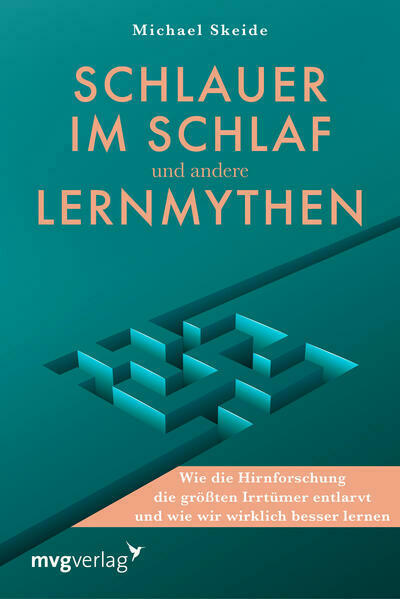"Wie gewonnen, so zerronnen"
Felix Schmidtner in FALTER 17/2025 vom 23.04.2025 (S. 43)
Kreuzworträtsel verbessern die Lernfähigkeit. Frauen sind schlechter in Naturwissenschaften. Die linke Gehirnhälfte ist die analytische, die rechte die kreative. Solche Mythen rund ums Lernen halten sich hartnäckig.
Michael Skeide faszinieren sie schon lange. Er ist Entwicklungspsychologe am Max-Planck-Institut für Kognitions-und Neurowissenschaften in Leipzig und forscht zur frühkindlichen Entwicklung. Etwa, wie sechs Monate alte Babys mit einfachen Lernaufgaben umgehen. Es sind also grundlegende Fragen, die Skeide umtreiben.
Nun hat Skeide ein Buch geschrieben, das sich mit Lernmythen beschäftigt und am 15. April erschienen ist. Eigentlich, erzählt der 41-jährige Deutsche im Interview via Zoom, wollte er lediglich das "Rüstzeug" liefern, damit Leser selbst "reflektieren" können. Doch der Verlag wünschte sich "mehr Handreichung". Und so finden sich auf den 145 Seiten einige Ratschläge, wie man die eigene Lernfähigkeit verbessert.
"Aber erwarten Sie bitte keine magischen Wunderwaffen", so Skeide. Womit wir gleich beim Thema wären.
Falter: In Ihrem Buch beschreiben Sie ein Experiment mit giftigen Pfeilgiftfröschen, die im Amazonasgebiet leben. Was haben diese mit dem Lernen zu tun, Herr Skeide?
Michael Skeide: Ein beliebtes Argument für das Schattendasein von Mädchen und Frauen in naturwissenschaftlichen Fächern, das wir häufig noch beobachten, ist, dass es evolutionsgeschichtlich "schon immer so war". Dass die Frauen die Kinder gehütet haben und Männer auf die Jagd gegangen sind, wo "Ingenieurskünste" und räumliche Orientierung gefragt waren. In dieser Studie wurde der Bewegungsradius der Frösche über Jahre hinweg mit Geotrackern verfolgt. Heraus kam, dass die Männchen tatsächlich größere Flächen durchforsteten als die Weibchen. Aber das hinderte sie keineswegs daran, sich gleichermaßen um den Nachwuchs zu kümmern.
Was sagen diese Ergebnisse über den Menschen aus?
Skeide: In der Diskussion über vermeintliche kognitive Unterschiede zwischen Frauen und Männern wird bisweilen argumentiert, dass sich diese aus einer "naturgegebenen" Aufgabenverteilung ergeben. Die wäre überall in der Tierwelt zu beobachten. Das Beispiel zeigt, dass dieser Zusammenhang nicht zwingend ist.
Ein ganzes Kapitel widmen Sie "Frauenund Männergehirnen". Zu welcher Erkenntnis kamen Sie?
Skeide: Sie kennen vielleicht den Ratgeber "Wieso Männer nicht zuhören, aber Frauen nicht einparken können" von Allan und Barbara Pease. Er erschien 1998 und stand lange auf den Bestsellerlisten. Der Titel fasst gut das Stereotyp zusammen, mit dem ich aufräumen möchte. Es ist ein Irrtum, genetische oder neuronale Unterschiede dafür verantwortlich zu machen, dass Frauen in MINT-Berufen unterrepräsentiert sind. Entscheidend sind gesellschaftliche Rollen, die sich über Jahrtausende verfestigten und Mädchen und Frauen vermutlich dahin leiten. Das ist also eine kulturelle Problematik. Wahrscheinlich gibt es hier auch bereits in früher Kindheit Unterschiede in der sozialen Interaktion.
Zum Beispiel?
Skeide: Wahrscheinlich ist es so, dass Eltern unbewusst mit den Babys anders umgehen. Das fängt damit an, dass sie mit den Jungs "räumliche Spiele" spielen, also zum Beispiel Bauklötze aufbauen. Das belegen zahlreiche Studien. Bei Mädchen werden diese "technischen" Spielformen womöglich weniger gefördert, zum Beispiel, weil man traditionell Technik mit männlichen Kompetenzen verbindet. So kann es passieren, dass schon früh Steine in Lernwege gelegt werden.
"Neuroplastizität", also die Veränderung der Nervenzellen im Gehirn, ist ein Buzzword im Netz. Gibt es die überhaupt beim Menschen?
Skeide: In der frühen Kindheit sehen wir atemberaubende Neuroplastizität. Da können eine Million neue Synapsen, also Verbindungen, pro Sekunde entstehen. Später geht es ruhiger zu. Aber wir sehen schon auch, dass manche Bereiche des Gehirns lebenslang eine erstaunlich hohe Plastizität haben. Etwa der Hippocampus, der unter anderem für das Schaffen von Erinnerungen zuständig ist. Bei der Verschaltung der Neuronen durch neue Synapsen hat das Gehirn einen klugen Kompromiss gefunden: Gelerntes wird einerseits stabilisiert, damit es nicht verloren geht. Allerdings bleibt eine gewisse Flexibilität, sodass man auch im hohen Alter noch etwas Neues lernen kann.
Was ist Ihrer Meinung nach der größte Mythos zum Thema Lernen?
Skeide: Eine verbreitete Vorstellung ist, dass die zwei Gehirnhälften für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind. Die linke Gehirnhälfte soll analytisch, zahlenorientiert, nüchtern und sachlich sein und die rechte Gehirnhälfte der Gegenpol: kreativ, emotional, ungeordnet, chaotisch. Damit einher geht die Idee, dass man die Gehirnhälften mit Übungen erst zusammenbringen muss. Das ist natürlich Quatsch.
Gehirnjogging ist also auch ein Mythos?
Skeide: Viele Menschen glauben, dass Sudokus oder Kreuzworträtsel die Lernfähigkeit fördern, aber die wissenschaftlichen Daten sprechen eigentlich dagegen. Solche Übungen machen uns in erster Linie besser im Sudoku oder im Kreuzworträtsel. Der Transfereffekt auf Fähigkeiten in anderen Bereichen ist dagegen gering. Ein weiterer Irrtum ist die Annahme, dass etwas für immer bleibt, wenn man es einmal gut gelernt hat. Für Autofahren oder Klavierspielen mag das stimmen. Für geistige Fähigkeiten wie das Arbeitsgedächtnis gilt aber oft: Wie gewonnen, so zerronnen.
Was hilft denn nun beim Lernen?
Skeide: Der unmittelbare Effekt von Sport ist zwar an sich eher gering, aber regelmäßige intensive Bewegung kann indirekt zum Erhalt der Lernfähigkeit beitragen, zum Beispiel, indem sie unsere Schlafqualität erhöht. Es lohnt sich also, in Bewegung zu bleiben. Zweitens: Neugierde. Das führt nämlich dazu, dass man liest, sich informiert, mit Leuten austauscht und Fragen stellt. Das zeigen auch Studien: Werden Menschen lange auf die Folter gespannt, können sie sich die begehrten Informationen anschließend besser merken.