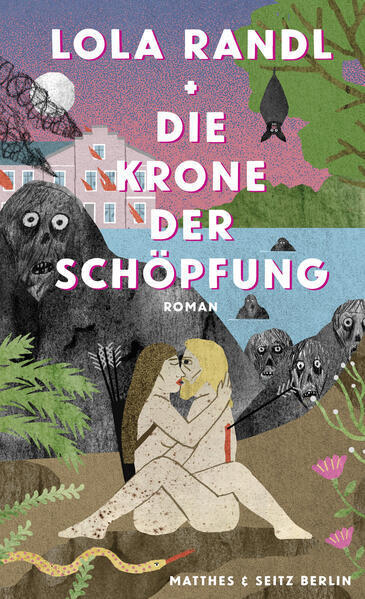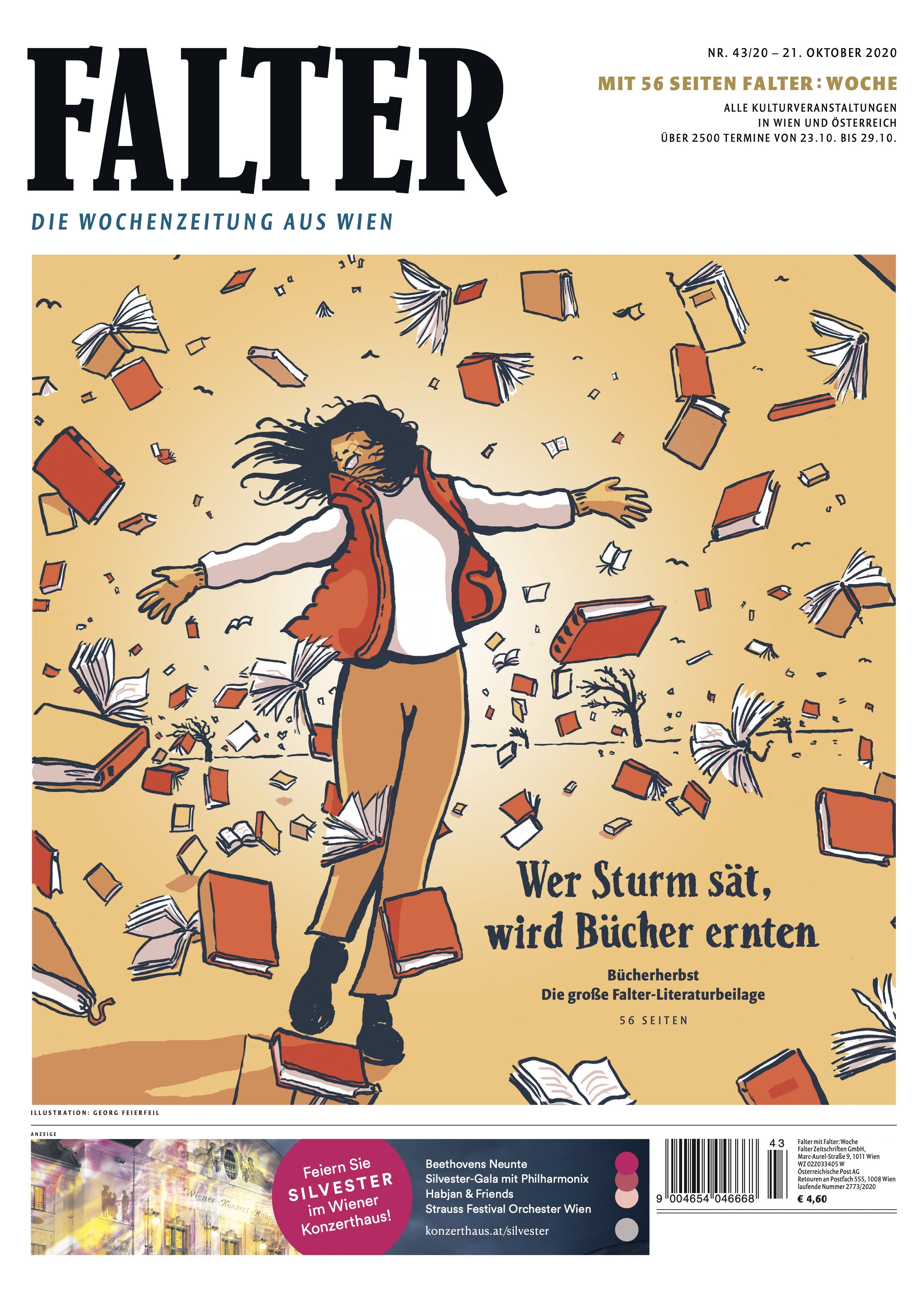
Corona oder die Liebe zur Provinz
Björn Hayer in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 24)
Die Literatur hat einen neuen Star, einen Bösewicht der Extraklasse. Er ist unsichtbar, unberechenbar und derzeit noch unbekämpfbar: Das Coronavirus infiziert Körper, unser Denken und naturgemäß auch unsere Geschichten. Mag man einerseits gehofft haben, dass sich Schriftstellerinnen im Schatten des Lockdown neu erfinden würden, hat man andererseits dürftige Selbstumkreisungen in der Isolation befürchtet.
Ein Beispiel dafür, dass sich vorerst eher die ernüchternden Vorahnungen bestätigt haben, stellt Lola Randls neuer Roman „Die Krone Der Schöpfung“ dar. Wie schon ihr Debüt, „Der große Garten“ (2019), basiert auch dieser auf autobiografischen Elementen. Erneut nehmen wir am Landleben der 1980 geborenen und erst vor einigen Jahren in die Uckermark gezogenen Autorin teil, begleiten sie beim Gang auf den Markt oder bei ihrem Versuch, ihre liaison d’amour mit dem Liebhaber therapeutisch zu retten, ohne den Ehemann zu verprellen. Wir sind live bei Homeschooling oder beim Beobachten der Nachbarn dabei.
Diese Form erzählter Authentizität, für die Randls Schreiben steht, wird zugleich von beständigen Reflexionen über die Folgen von Covid-19 ergänzt. Während die Erzählerin bemüht ist, das begriffslose Geschehen der Pandemie durch eine enzyklopädische Gliederung mit Überschriften wie „Infektion“, „Epidemie“ oder „Superspreader“ in den Griff zu bekommen, wird sie selbst zu einer Panikpatientin.
Das Virus schleicht sich nachts gleich einem Albtraum in das Innere der Schriftstellerin. Befördert werden Ängste durch Liveticker, Hamsterkäufe des Mannes (Vitamintabletten!) und leere Straßen. Und was wäre angesichts dieser Lage und gemäß des Klischees für eine Schriftstellerin naheliegender, als eine Zombieserie zu schreiben, die sich wie ein roter Faden durch die tagebuchartigen Miniaturen zieht?
Randl gelingt eine Chronik der Ereignisse und Gefühlslagen, eine Bestandsaufnahme der Ohnmacht und Orientierungssuche in einem chaotischen Moment der Geschichte. Eine weitergehende Analyse der Krise vermag ihr Buch hingegen nicht zu entwickeln, stattdessen bemüht es eine Reihe banaler Einsichten:„Innerhalb von Herden ist Nähe ein Ausdruck von Zugehörigkeit […] zu einer Spezies, weswegen Gefühle der Einsamkeit nicht ausblieben, aber die meisten gewöhnten sich irgendwie daran.“ Soso.
Ähnlich erhellend fallen auch Hinweise zur Abstandspflicht von 1,5 Metern und deren Beachtung bei Veranstaltungen aus: „Bei Festbestuhlung in Räumen blieben immer drei Plätze frei […]. Waren die Stühle beweglich, bildete sich ein seltsames Muster aus wenigen Stühlen und viel Platz. Aber es kamen ja zu allem auch nur noch die, die unbedingt mussten, also kaum einer.“
Angesichts einer derartig ermüdenden Suada dürften manche Leserinnen sogar die ohnehin schon nervtötenden Corona-Talkshows vorziehen. Aber nicht nur die weitestgehende Inhaltsleere des Textes stößt bei der Lektüre übel auf, auch die Komposition lässt alle höhere Ambition vermissen. Mit dem Ansatz, die Welt in ihrer naturalistischen Echtheit zu beschreiben, verweigert sich Randl einer Metaebene. Nur da und dort finden sich zwischen Zutatenlisten für den Sauerteig und einer Polemik gegen den Pandemie-Profiteur Amazon reflexive Passagen zur Pest oder zum Modell der Heldenreise, das uns wohl als Anleitung zum Bestehen der Krise dienen soll.
Ein intensiveres und erkenntnisstiftendes Nachdenken über die Ursachen und Lehren von Corona vermisst man ebenso wie einen ästhetischen Erneuerungsschub. So aber reicht der Radius des Romans über die nächsten Felder des Dorfes nicht hinaus.