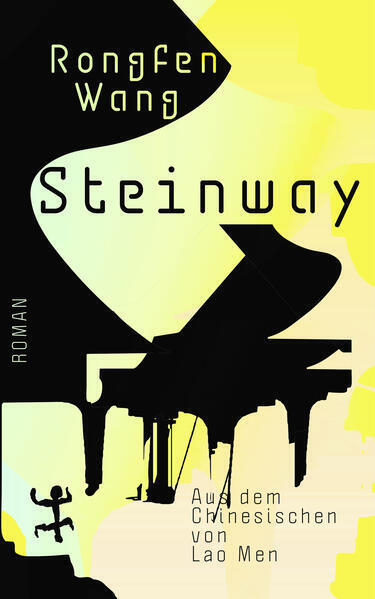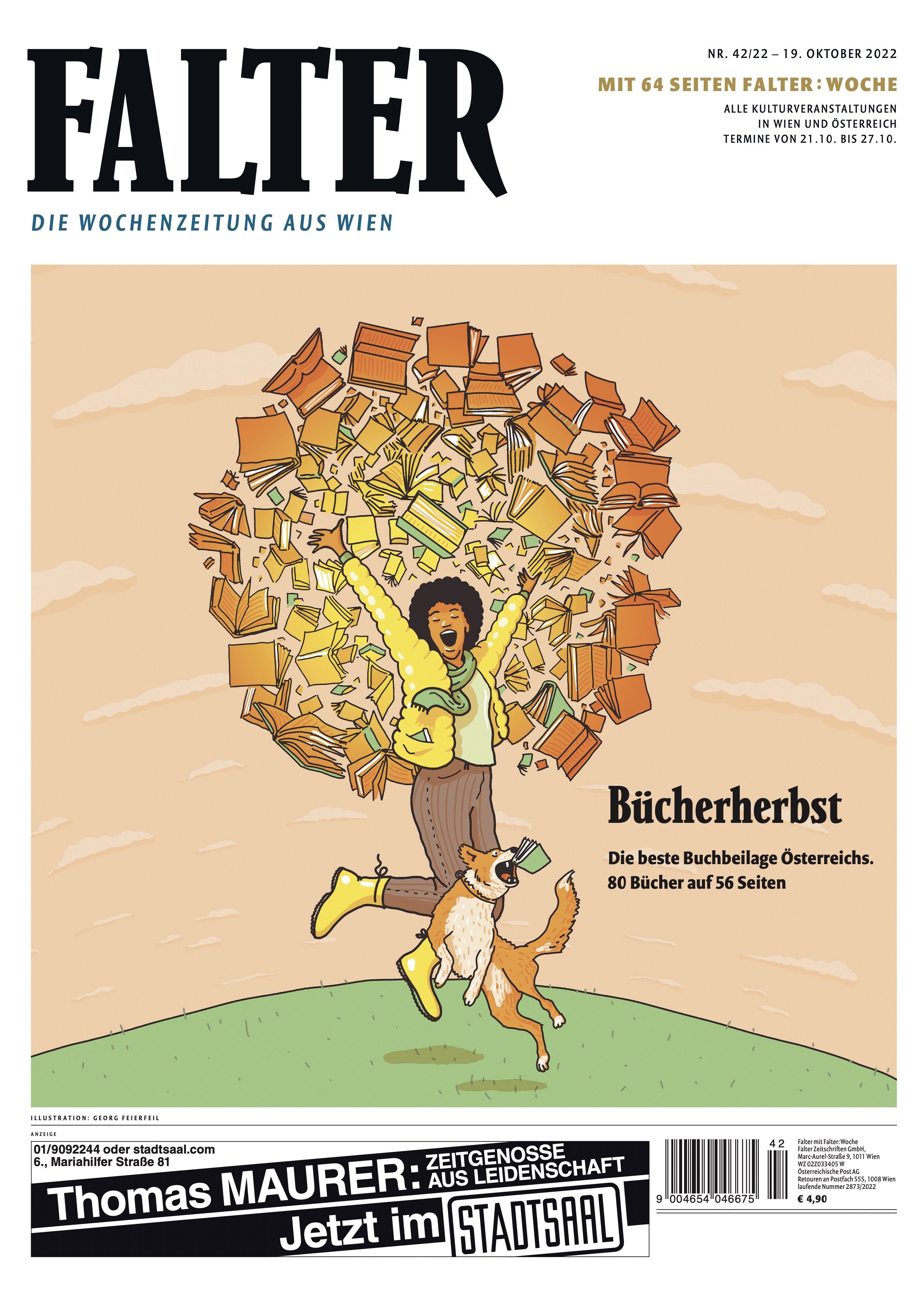
„Chinesische Menschenleben sind billig“
Miriam Damev in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 25)
Derart böse waren doch nicht mal die Nazis, oder?“, fragt Shi Sun. „Du kannst das eine nicht mit dem anderen vergleichen, aber es gibt immer noch bösere“, antwortet ihm seine Großmutter. „Die Nazis haben sechs Millionen Juden ermordet. In der Kulturrevolution wurden fünfmal so viele Chinesen zu Tode gebracht. Schon wenn ich an die Gaskammern nur denke, wird mir schlecht.“
Auf knapp 500 Seiten beschreibt Wang Rongfen in ihrem autobiografischen Roman „Steinway“ die Gräuel der Roten Garden. Sie erzählt die Geschichte aus der Sicht von Shi Sun, einem Jungen, der gemeinsam mit seiner Schwester Shi Zhu auf einem alten Steinway Klavier spielen lernt. Das prachtvolle, mit Perlmutteinlagen verzierte Instrument hat Tasten aus Sandelholz und Elfenbein und ist eine Reminiszenz an die „herzzerreißende Schönheit“ vergangener Zeiten. Hier entspinnt sich die Erzählung der Klavierlehrerin Cheng Pinzhi, die als Alter Ego der Autorin nach der Kulturrevolution als Orchestermusikerin arbeitet und selbst von Mao umgarnt wird – bis der Mann ihrer Schwester sie anschwärzt, was zu Chengs Verhaftung führt.
Mit rasender und zugleich poetischer Sprache schildert Wang die unmenschliche Brutalität des Mao-Regimes. Grausame Details spart die Autorin, die selbst 13 Jahre in chinesischen Gefängnissen verbracht hat, nicht aus: „Das Gemisch von Blutgeruch, verschwitztem Körper- und Uringestank biss in die Nase, schmerzte die Augen wie Pfefferspray.“
Cheng teil sich in den sieben Jahren ihrer Haft die Zelle unter anderen mit einer Apothekerin, einer Vizeabteilungsleiterin der Pekinger Stadtverwaltung und einer Mitarbeiterin des Museums der Chinesischen Revolution. Sie trifft auf eine Frau, die als Einzige ihrer Familie das Massaker von Daxing überlebt hat, dessen Tote man in einem Schilfteich entsorgt hatte: „Kleine Kinder, die noch lebten, waren wieder herausgekrochen; mordgierige arme und untere Mittelbauern hatten ihnen mit Eisenschaufeln die Schädel zertrümmert.“
Wang Rongfen, die mit 16 Jahren in den kommunistischen Jugendverband aufgenommen wird, erlebt die Kulturrevolution aus nächster Nähe. Sie beobachtet, wie Jugendliche grölend auf den Friedhof im Universitätsviertel die Knochen des berühmten Malers Qi Baishi ausgraben – und lässt die Schändung im Roman noch einmal Revue passieren lässt. „So plötzlich war die Kulturrevolution hereingebrochen, die Menschen hatten sich ihr noch nicht anpassen können, mochten sich noch nicht an Lebenden vergreifen und übten sich erst einmal an den Toten.“
In den 1950er-Jahren verursacht Mao mit seinem „Großer Sprung nach vorn“ eine Hungersnot, die 55 Millionen Chinesen das Leben kostet. Weil er sich danach in seinen eigenen Reihen nicht mehr sicher fühlt, ruft er 1966 die „Kulturrevolution“ aus. Unter dem Vorwand, „Reaktionäre“ zu bekämpfen, beginnt eine gigantische Säuberungsaktion, an deren Spitze die Roten Garden stehen: Schüler- und Studentengruppen sollen „alles ‚Vierfach Alte‘ – Ideen, Kultur, Sitten, Angewohnheiten – vernichten, plündern und dabei ‚Revolution ist kein Gastmahl‘ grölen und Menschen totprügeln“, schreibt Wang. Ihr Roman ist ein ebenso packendes wie beklemmendes Stück Zeitgeschichte von Maos Machtkampf über die Kulturrevolution bis zum Tian’anmen-Massaker 1989.
Im Gefängnis lernt Cheng auch Liu Yalan kennen, die längst in Pension ist, als man ihr Spionage vorwirft. Ihre Wohnung wird durchsucht, die Katze von den „Rotgardisten totgeschmissen“ und die vier 16 Zentimeter langen Goldfische „mit bloßen Händen zerquetscht“. Als sie vom Tod ihres Mannes erfährt, nimmt sie ein Küchenmesser, sticht sich in den Kopf – und überlebt. Ihren Zellengenossinnen gegenüber meint sie lakonisch: „Ich bereue, dass ich mit dem Messer nicht heftig genug zugestochen habe, nicht kräftig genug, damit es was gebracht hätte.“ Eine andere Mitinsassin befindet sich mit hinter dem Rücken gefesselten Händen wochenlang in Einzelhaft und liegt in ihren Exkrementen, ihrem Urin und Menstruationsblut. Als sie schließlich das Essen verweigert, wird sie mit Maismehlsuppe durch die Nase zwangsernährt und geht dabei elendig zugrunde. Ein Wärter brüllt die völlig entkräftete Frauen beim Abortgang an: „Los, los, was trödelt ihr Fotzen […], wartet ihr auf den Fick?“ Chinesische Menschenleben seien eben billig, lautet das bittere Resümee der Autorin.
Cheng Pinzhi hat überlebt, wird schließlich aus der Haft entlassen und rehabilitiert. Auch Wang Rongfen kommt 1979 frei und wird gleichfalls rehabilitiert und darf an die Hochschule zurückkehren. Als im Juni 1989 Panzer über den Platz des Himmlischen Frieden rollen und die studentische Demokratiebewegung niederschießen, flieht sie nach Deutschland, wo sie noch heute lebt. „Des erhabenen Führers Erziehungsreform in drei Sätzen zusammengefasst! Scheiß der Hund auf Mao stinkt-stank, versaut das Land, versaut das Volk!“