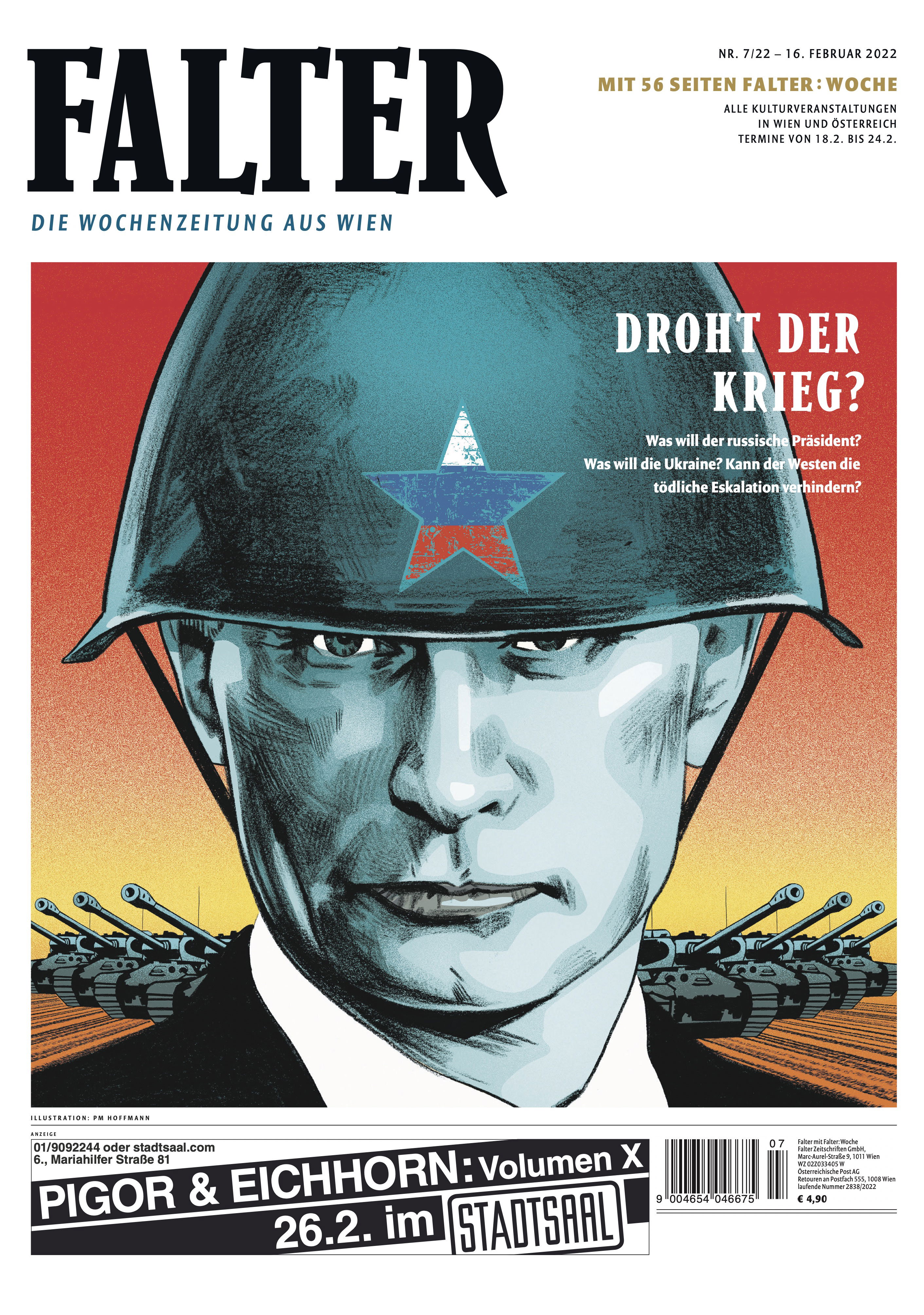
Was ist noch Unglück und was schon Ungerechtigkeit?
Kirstin Breitenfellner in FALTER 7/2022 vom 16.02.2022 (S. 19)
Das Buch der Politologin Judith N. Shklar "Über Ungerechtigkeit" war lange vergriffen, nun liegt es wieder vor
Gerechtigkeit ist abstrakt. Niemand kann sicher sagen, ob es sie gibt. Aber jeder hat ein konkretes Gefühl dafür, was ungerecht ist. Warum nicht also den Spieß umdrehen und über Ungerechtigkeit philosophieren?, dachte sich Judith N. Shklar. Das Buch der Politologin, die an der Harvard University lehrte und 1992 starb, erschien im Original bereits 1990 -und hat seitdem nichts an Frische eingebüßt. Im Gegenteil, es ist erstaunlich, wie sehr die US-amerikanischen Thematiken der 1980er-Jahre den Diskurs auch hierzulande heute noch prägen.
"Über Ungerechtigkeit. Erkundungen zu einem moralischen Gefühl" geht von der Frage aus, wann eine Katastrophe als Unglück und wann als Ungerechtigkeit eingestuft werden kann. Die Grenze zwischen diesen beiden Interpretationen, lautet Shklars These, sei volatil, denn was als unvermeidlich und was als kontrollierbar angesehen werde, gehöre zu den politischen Entscheidungen und hänge zudem von der Entwicklung der Technik ab. Die gängigen Gerechtigkeitsmodelle seien nicht in der Lage, eine angemessene Definition von Ungerechtigkeit zu liefern, weil sie "an dem unbegründeten Glauben festhalten, wir könnten einen unveränderlichen und starren Unterschied" zwischen diesen beiden Sphären festlegen.
Frau sein als Unglück
Tatsächlich wurde es etwa früher als Unglück betrachtet, als Frau oder Person of Colour geboren zu sein, während die Benachteiligung dieser Personengruppen heute als Ungerechtigkeit angesehen wird. Wurde die Züchtigung von Kindern vor wenigen Jahrzehnten noch als Privatsache abgetan, gilt sie heute als öffentlich und wird damit strafbar. Sogar Naturkatastrophen und ihre Folgen werden nicht mehr als naturgegeben hingenommen, weswegen auch nach solchen stets nach Tätern gesucht wird. Diese Entwicklung sieht Shklar nicht nur negativ. Sie habe mit der gestiegenen Bereitschaft zu tun, die Perspektive der Opfer ernst zu nehmen. Der gesellschaftliche "Sport" in Demokratien, sich gegenseitig anzuklagen, sei hingegen der hohen Erwartung des Einzelnen an die Gesellschaft und dem technischen Fortschritt geschuldet. Mit ihr gehe auch ein erhöhter Hang zu Verschwörungstheorien einher.
Passive Ungerechtigkeit
Shklars Gedankengänge sind gut nachvollziehbar, die Exkurse in die Philosophiegeschichte lehrreich. Als Denkerin in der Tradition des Skeptizismus versucht sie, die von ihr betrachteten Phänomene nicht in ein abgeschlossenes Denksystem zu pressen. Ist Ungerechtigkeit die Abwesenheit von Gerechtigkeit? Solche Fragen sind schwer zu beantworten. Denn: "Oft begehen genau diejenigen, die doch Ungerechtigkeit verhindern sollen, die schlimmsten Akte der Ungerechtigkeit -und zwar in ihrer offiziellen Funktion -, ohne dass die Bürgerschaft laut dagegen protestierte."
Shklar rückt deswegen die passive Ungerechtigkeit, die von Politik und Behörden ausgeht, die nicht eingreifen, obwohl sie es tun sollten und könnten, immer wieder in den Fokus. Nach dem US-amerikanischen Demokratieverständnis muss der Bürger nicht nur vor seinen Mitbürgern, sondern auch vor den Mächtigen geschützt werden. Auch forcierter Paternalismus, der die Inkompetenz der Staatsbürger voraussetzt, gehört für Shklar zu den Ungerechtigkeiten. Passiv ungerecht können aber auch Staatsbürger sein, die sich nicht gegen ungerechte Gesetze und Verordnungen einsetzen. Eine gute Erinnerung!



