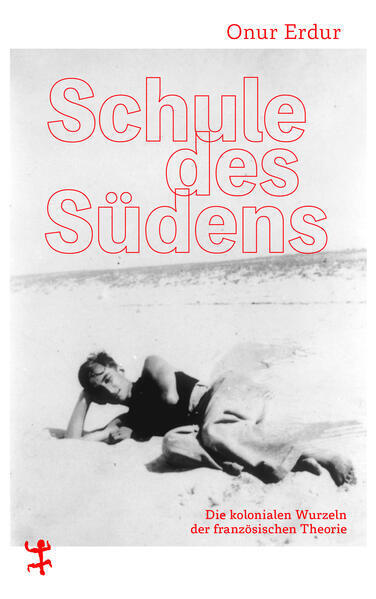Die Gesellschaft mit den Augen der Anderen sehen
Robert Misik in FALTER 30/2024 vom 24.07.2024 (S. 17)
Im Debatten-Getöse über "Wokeness" oder "Postkolonialismus" wird gerne genörgelt, amerikanische Simplifizierungen würden zu uns herüberschwappen. In den USA wiederum ist häufig zu hören, der radikale Manichäismus sei Folge des "postmodernen" französischen Denkens, sei quasi eine Pariser Krankheit.
Blöde versimpelt ist beides. Doch in diesen aktuellen Kontext hinein liest sich Onur Erdurs brillante und elegante Studie "Schule des Südens" mit noch mehr Gewinn. Der Berliner Kulturwissenschaftler legt eine wenig beachtete Geschichte frei -nämlich die Bedeutung der kolonialen Erfahrung für die legendären Begründer des französischen Nachkriegsdenkens, für Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Étienne Balibar und viele andere.
Kolonialismus war meist nicht allein durch Gewalt oder Ausrottung gekennzeichnet, sondern mit ideologischen Erzählungen getränkt. Etwa mit einem historischen Fortschrittsmodell -dass "der Westen" eben fortschrittlicher sei als "die Anderen" - oder mit einer behaupteten "Zivilisierungsmission", also dass man die Wilden erziehen müsse. Imperialismus ging oft mit der Besiedelung der Länder einher, durch Kolonialisten aus den imperialen "Mutterländern". Algerien war dafür ein Beispiel mit seinen französischstämmigen Siedlerkolonialisten, den "Pieds Noirs". "Die Anfänge der französischen Theorie", so Erdur, fallen nun aber genau mit der Epoche der Dekolonisierung zusammen.
So ging etwa der junge Philosoph Pierre Bourdieu als Besatzungssoldat während seines Militärdienstes nach Algerien. Die Rekruten hatten, noch bevor sie einen Fuß auf algerischen Boden gesetzt hatten, das ganze "Alltagsvokabular des Rassismus" übernommen, die Vorstellungsreihen vom "faulen Eingeborenen", den "verschlagenen, impulsiven Arabern".
Bourdieu studiert die algerische Sozialstruktur, die feinen und die groben Unterschiede, bemerkt, wie sehr der französische Kapitalismus auf "Verhaltensdispositionen" der Bürger aufbaut, die den Kolonisierten völlig fremd sind. Bourdieu entwickelt sein Habitus-Konzept erstmals durch diese Erfahrung und wird nach seinem Militärdienst vom Philosophen zum Soziologen.
Ähnlich Jean-François Lyotard, der spätere Autor des Schlüsselwerkes über "das postmoderne Wissen". Als Dozent in Algerien macht er die Erfahrung, "die Verachtung ist europäisch, das Elend dagegen 'arabisch'". Zurück in Frankreich unterstützt er die Untergrundaktionen der Algerien-Befreiungsfront als illegaler Geldschmuggler.
Diese Grenzgänger, aber auch algerische Juden wie Jacques Derrida leben zwischen den Großerzählungen. Derrida lebt zwischen den Identitäten -Algerier, Franzose, Jude - und wird zum Theoretiker der "Dekonstruktion", der alle kulturellen Gewissheiten auseinandernehmen wird. Sein Interesse an Identität speise sich eigentlich, sagte Derrida später einmal, aus dem "Fehlen einer Identität". Selbst für den dandyhaften Michel Foucault wird seine tunesische Erfahrung wichtig. Nicht in Paris radikalisiert er sich, sondern in den 1968er-Jahren als Dozent in Tunis.
Die Theoretiker haben dem heutigen postkolonialen Denken viel gegeben -etwa die Entlarvung von "Wissen" als Ideologie, die Brüchigkeit von kongruenten Welterzählungen, die Zerstörung "orientalistischer" Stereotypisierungen -, können aber gerade nicht für Schwarz-Weiß-Denken in Beschlag genommen werden. Im Gegenteil: Bei ihnen lernt man, jeweils mit den Augen der Anderen zu sehen.