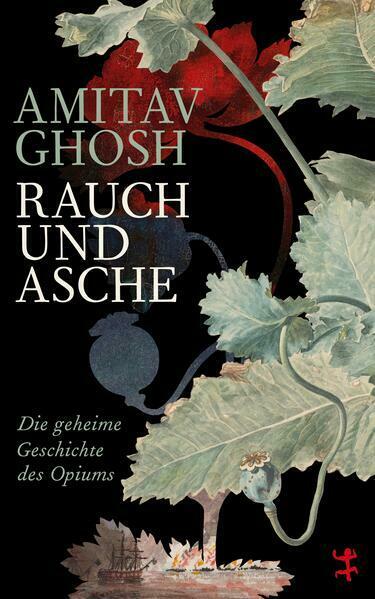Globaler Horrortrip
Oliver Hochadel in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 32)
Der indische Autor Amitav Ghosh gilt als eine wichtige Stimme der Gegenwart: Er zeigt auf, wie eng die Geschichte von Kolonialismus, Umweltzerstörung und Klimawandel verflochten sind – eindrücklich etwa in seinem vorletzten Buch „Der Fluch der Muskatnuss“. In seinem neuesten Werk kehrt er als Historiker zu einem Thema zurück, das er als Schriftsteller in seiner Ibis-Trilogie meisterhaft abgehandelt hat: den Opiumhandel zwischen Indien und China, der zum Ersten Opiumkrieg (1839–1842) führte. Wer glaubt, dass es sich dabei um eine längst vergangene Episode vom anderen Ende der Welt handelt, den belehrt Ghosh eines Besseren. Der ostasiatische Opiumhandel des 19. Jahrhunderts hat den Weltenlauf nachhaltig beeinflusst und ist in seinen Ausläufern bis heute greifbar.
„Rauch und Asche“ ist eine Abrechnung mit Kolonialismus und der Ideologie des Freihandels. Das Britische Empire war, kein Witz, im 19. Jahrhundert ein Narco-State. Einen wesentlichen Teil seiner Einnahmen bezog das Empire aus dem in Britisch-Indien angebauten Opium, das nach Ghangzhou (die Europäer sagten: Canton) geliefert wurde und Millionen von Chinesen in die Sucht trieb. „Die erschütternde Realität ist, dass viele Städte, die heute Säulen der modernen globalisierten Wirtschaft sind – Mumbai (früher: Bombay), Singapur, Hongkong und Shanghai –, sich ursprünglich vom Opium speisten.“
Als das Reich der Mitte das Vernichtungswerk der Opiumsucht zu unterbinden suchte, zwangen die Briten es mit den Kanonen ihrer überlegenen Seemacht, den Hafen von Ghangzhou wieder zu öffnen, und annektierten Hongkong. Das Empire berief sich dabei auf die Ideologie des Freihandels. Konkurrenz und die „unsichtbare Hand“ nach Adam Smith waren angeblich der Königsweg zum Wohlstand aller.
Der Opiumhandel hatte jedoch rein gar nichts mit dem „freien Markt“ zu tun. Die Produktion einer Substanz, die unfrei machte, beruhte auf ausbeuterischer Zwangsarbeit indischer Bauern, dominiert von wenigen privilegierten Akteuren. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war es dann vorbei mit dem florierenden Opiumhandel Großbritanniens mit China. Statt Staaten übernahmen allmählich internationale Verbrecherkartelle den lukrativen Handel.
Neben britischen und indischen Händlern verdienten auch amerikanische Investoren ein Vermögen mit der Sucht. Für viele der mächtigen Familien der US-Ostküste diente der Reibach aus dem Opiumgeschäft als seed money, also als Startkapital etwa zur Konstruktion der Eisenbahn und zur Erschließung des amerikanischen Westens im späteren 19. Jahrhundert.
Für China ist der „heldenhafte“, wenngleich erfolglose Kampf im Ersten Opiumkrieg zum Grundstein des Nationalismus sowie des nach wie vor verbreiteten Narrativs geworden, der Westen sei heuchlerisch.
Ghosh verweist auch auf die Parallelen zur Opiodkrise, die seit der Jahrtausendwende die USA heimsucht und Hunderttausende von Toten forderte. Gier (eine rücksichtslose Pharmaindustrie im Verein mit korrupten Ärzten und Anwälten) und Schuldumkehr (verantwortlich für ihre Sucht seien die Opiumkonsumenten, nicht die Anbieter) sind auch hier am Werk. Schon die britischen Kolonialherren verachteten die Chinesen als schwächlich, da sie dem Rauschmittel verfielen. Das Loblied von Kapitalismus und Eigenverantwortung klang selten hohler.
Der Schlafmohn bestimmt also unser Geschick als Menschen seit der Antike mit. Opium lindert Schmerz, macht aber auch abhängig und tötet. Es korrumpiert Menschen, Behörden und ganze Staaten. Opium macht reich und arm, beflügelt Volkswirtschaften, schlägt Schneisen durch Landschaften und führt zu Krieg. Ghosh plädiert eindringlich dafür, die unscheinbare Pflanze als wirkmächtigen historischen Akteur zu begreifen – und zu handeln: Niemals wurde global so viel Opium produziert wie heute.