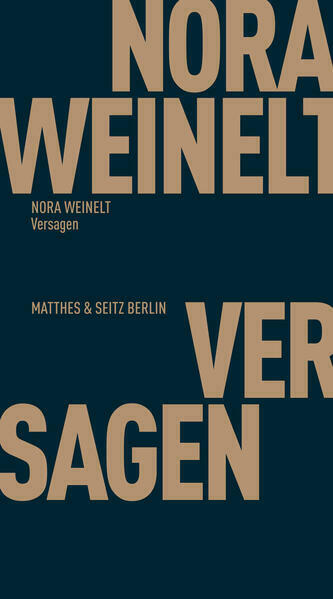Der Mythos vom schönen Scheitern
Klaus Nüchtern in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 29)
Offenkundig irre Typen wie Donald Trump und Elon Musk werden vielleicht nicht die Weltherrschaft übernehmen, den Willen, dies zu tun, kann ihnen aber niemand absprechen. Und selbst wenn sie scheitern, könnten sie das als Erfolg verbuchen. Denn wie meinte Musk bereits vor zehn Jahren: “If things are not failing, you are not innovating enough.”
Die Literaturwissenschaftlerin Nora Weinelt, Jahrgang 1986, beginnt ihre Untersuchung über das Phänomen und den Begriff des Versagens, indem sie das im Laufe der 1990er-Jahre hegemonial gewordene Narrativ des schönen Scheiterns analysiert. Als wirkmächtiges Ideologem des Neoliberalismus wird Scheitern nämlich als wertvolle Erfahrung verbucht, die geradezu die Voraussetzung für den finalen Erfolg darstellt.
Das von Start-up-Unternehmern, Life-Coaches und anderen Esoterikern öffentlich stolz thematisierte eigene Scheitern enthält notwendig einen „kritischen Wendepunkt“, an dem man es noch hätte abwenden können, dies aber verabsäumt hat.
Auf diese Weise wird eine Selbstermächtigungserzählung etabliert: Nicht höhere Mächte, Pech oder ein dummer Zufall, sondern man selbst war schuld – ein Umstand, der sich letztendlich in eine autobiografische Erfolgsgeschichte integrieren lässt: Man hat daraus gelernt und es in der Folge besser gemacht.
So gesehen sind Scheitern und Erfolg zwei Seiten derselben Medaille. Was dabei vorsätzlich ausgeblendet wird, ist die „durch und durch negative, das Subjekt in seinen Grundfesten erschütternde Form des Nichterreichens“, das Versagen nämlich. Historisch betrachtet ist es ein erstaunlich junges Konzept. Im deutschsprachigen Raum taucht es erst Ende des 19. Jahrhunderts auf, und die Figur des „Versagers“ findet dort überhaupt erst in den 1950er-Jahren Eingang in die Wörterbücher.
Höchst spannend liest sich der kurze Abriss, den Weinelt der Geschichte des Versagensdiskurses widmet. Der Begriff selbst wird zunächst vor allem im Kontext der Waffentechnologie – Stichwort: Rohrkrepierer – verwendet, ehe er um die Jahrhundertwende Eingang in die Humanwissenschaften findet; was wiederum als Symptom einer technizistisch verstandenen Anthropologie gewertet werden darf. Die Vorstellung des Leibeswesens Mensch als Maschine hat sich bis heute in Begriffen wie dem des „Organversagens“ erhalten.
Im Zeitalter der Automatisierung stellt das Versagen das Skandalon einer technischen Unbeherrschbarkeit dar, die es gar nicht geben dürfte; einen Vorgang, der sich unvorhergesehen im Inneren der Maschine ereignet und der Handlungsmacht des Individuums entzogen bleibt.
Der Mensch als „Versager“ ist nicht zuletzt eine Erfindung der Pädagogik. Allgemeine Schulpflicht, Regelschulwesen, Jahrgangsklassen und numerische Benotungssysteme etablieren jene Norm, von der die sogenannten „Schulversager“ abweichen. Wobei Versagen in diesem Kontext eben nicht als „abnormal“ im Sinne einer körperlichen oder geistigen Behinderung definiert wird, sondern als die Nichterbringung einer Leistung, die von den Individuen erbracht werden könnte.
Darin steckt, wie die Autorin im finalen Kapitel betont, auch ein Moment des Widerstands und der Renitenz, das von den Diskursen des Versagens geleugnet wird und in jenen des schönen Scheiterns gar nicht vorgesehen ist. Diese beruhen nämlich auf einem Imperativ permanenter Selbstüberbietung. Kritisch-analytisch auf den Punkt gebracht wird das Phänomen, so Weinelt, in den Romanen des französischen Skandalautors Michel Houellebecq. Dessen Anti-Helden ist es nicht mehr gegeben, in Schönheit zu scheitern. Ihr Versagen wird aber nicht mehr als individuelles begriffen, vielmehr indizieren sie eine Verschiebung der Denkfigur: „vom Versagen in einem zum Versagen des Systems“.