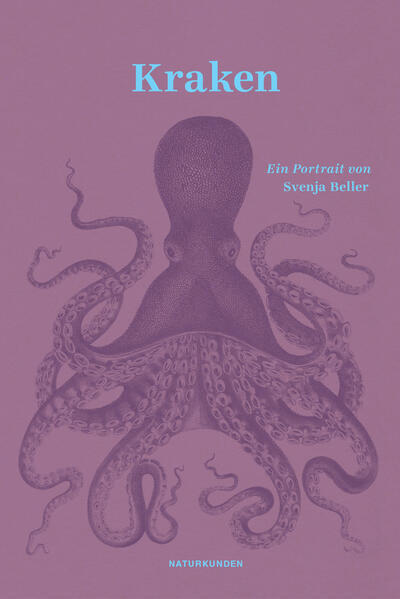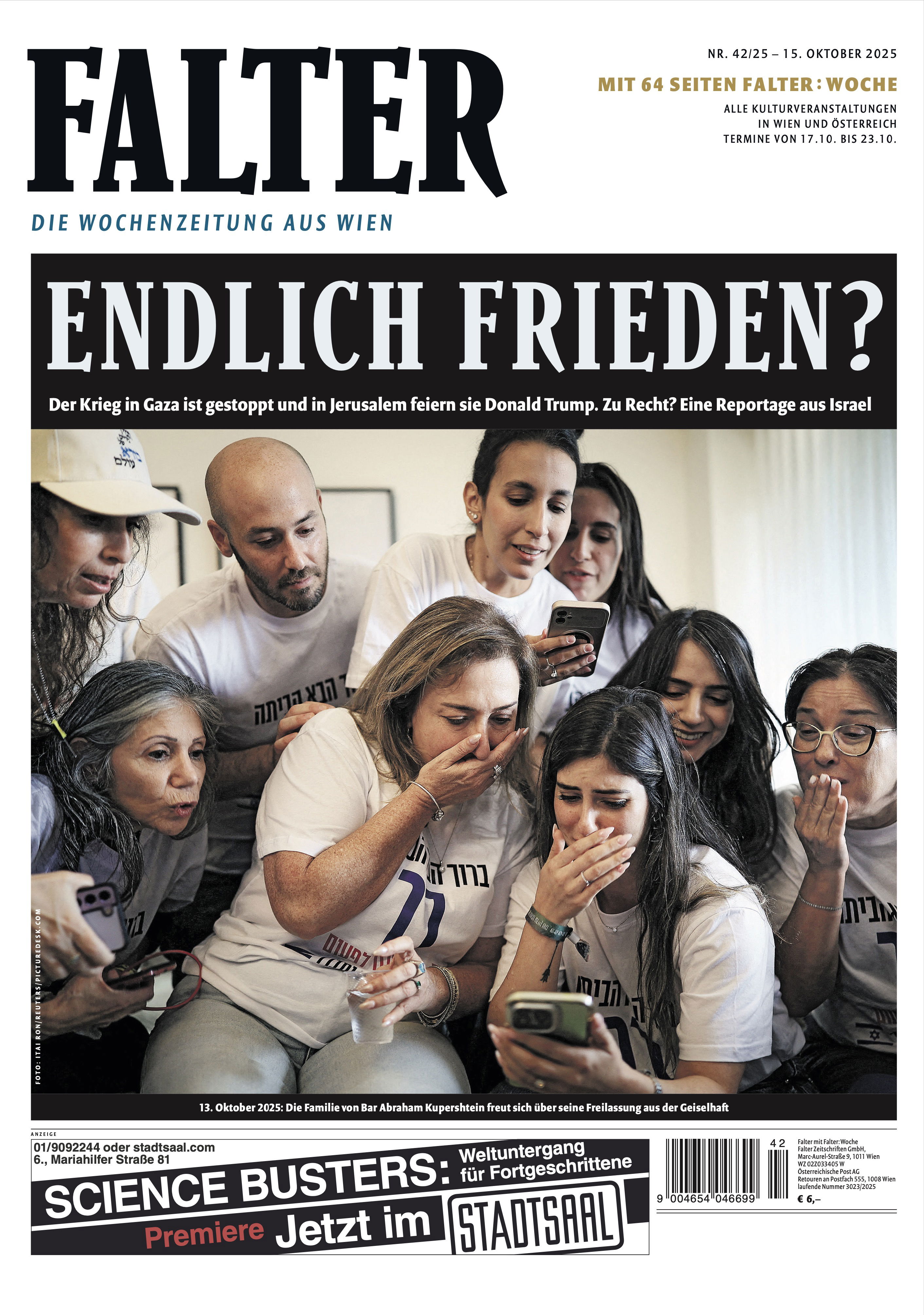
Monster, Maskottchen, Mastermind
Felice Gallé in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 42)
er Oktopus ist in. Lange als menschenverschlingendes Seeungeheuer verleumdet, ist er, in den Worten des Medientheoretikers Matthias Wittmann, „der Delfin von heute“. Oktopusse, auch Kraken genannt, gelten als Forschungsobjekte mit Star-Appeal und Medienlieblinge. Den Kraken Paul aus Oberhausen, der zahlreiche Titelspiele inklusive WM-Finale korrekt „vorhersagte“, kennen auch viele, denen Fußball egal ist. Die verantwortliche PR-Agentur hat sich mit dem Kraken-Orakel einen Preis geangelt. 2021 wurde der zwischen Tierdoku und Melodram changierende Film „Mein Lehrer, der Krake“ ausgezeichnet. Emmy-verdächtig präsentiert sich die kürzlich erschienene Miniserie „Die geheime Welt der Oktopusse“.
Trotz all der Aufmerksamkeit geben die Tiere mit den acht Armen, drei Herzen und (möglicherweise) neun Gehirnen noch viele Rätsel auf. Was wir zu wissen glauben, ist mitunter falsch: etwa, dass Kraken generell Einzelgänger, ja asozial seien. Oder dass sie Tentakel hätten. (Über solche verfügen nur Kalmare und Sepien, die zehnarmigen Tintenfische.) Ein neues Buch über Kraken ist daher zu begrüßen. Besonders wenn es nicht nur auf der Erfolgswelle schwimmen, sondern tiefer eintauchen will und auch problematische Entwicklungen thematisiert wie die Überfischung oder die menschengemachte Erwärmung der Ozeane. „Kraken. Ein Portrait“ von Svenja Beller, die unter anderem für Die Zeit und The Guardian schreibt, ist so ein Buch.
Wie Sy Montgomery in dem Bestseller „Rendezvous mit einem Oktopus“ verbindet Beller Wissenswertes mit Erlebtem, Evidenz mit Emotion. Sie verknüpft Meeresbiologie und Kulturgeschichte und schildert ihre eigenen Begegnungen mit Kraken bei Tauchgängen im Meer wie vor der Glasscheibe eines Aquariums – inklusive ihrer Sehnsucht „nach einem Ende der Entfremdung“: „Wir möchten, dass die Tiere sich mit uns anfreunden, dass sie uns etwas zu sagen haben. Und auch ich bin davon nicht frei.“
In acht doppelseitigen Porträts mit schönen Illustrationen zeigt Beller von der Algenkrake Abdopus aculeatus bis zum in 4000 Metern Tiefe lebenden Dumbo-Tintenfisch Grimpoteuthis bathynectes sehr unterschiedliche Beispiele der insgesamt rund 300 bekannten Krakenarten. Die klugen Weichtiere sind Meister im Tarnen, Verstecken und Entkommen. Doch immer bessere ferngesteuerte Unterwasserkameras fangen bisher unentdeckte Tintenfischarten ein, auch in der Tiefsee. Sie zeigen Tiere auf der Suche nach Schlafplätzen, bei Kampf, Sex und Spiel mit Artgenossen, auf der Flucht vor hungrigen Fischen, bei der Jagd auf Krabben – und ermöglichen einen neuen Blick auf Lebewesen, die viele Menschen zuvor nur paniert und gegrillt gesehen haben.
Allen neuen Erkenntnissen über ihre Intelligenz und Empfindungsfähigkeit zum Trotz nimmt der Appetit auf Oktopusse zu. Und damit die Gier auf das große Geschäft. Auf Gran Canaria soll die erste Kraken-Farm der Welt entstehen. Beller beschreibt das Vorhaben und zitiert kritische Stimmen wie den Wissenschaftsphilosophen Peter Godfrey-Smith, Autor des Buches „Der Krake, das Meer und die tiefen Ursprünge des Bewusstseins“. Und sie besucht jenes Unternehmen, das plant, Oktopusse zu vermehren, zu töten und zu vermarkten wie Schweine, Hühner, Rinder und weitere sogenannte Nutztiere. „Mit Farmen wie der von Nueva Pescanova entscheidet sich, ob die Oktopusse Teil dieser Leidensgemeinschaft werden oder ob sie davor bewahrt werden“, lautet Bellers Resümee.
Immer wieder sucht die Autorin die Nähe der Tiere. Eine Freundschaft mit einem Kraken entwickelt sich nicht. Bellers ausgestreckte Hand bleibt unbeachtet. Sie vermutet darin eine Botschaft: „Es geht nicht immer um uns und um unsere Beziehung mit dem Rest der Welt. Auch wenn manche Kraken neugierig auf manche Menschen reagieren, sind wir ihnen ultimativ doch egal.“ Umgekehrt sollte es nicht so sein. Eine Petition gegen die geplante erste Kraken-Farm kann man jetzt im Internet unterzeichnen.