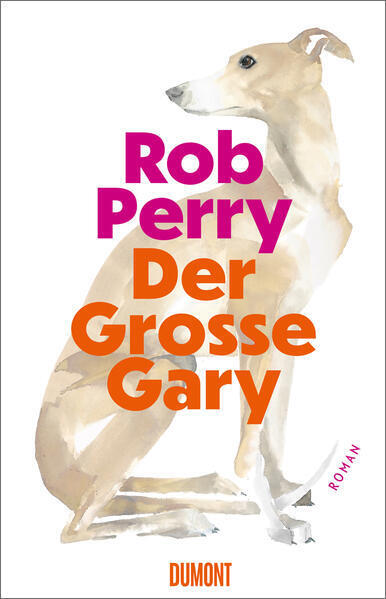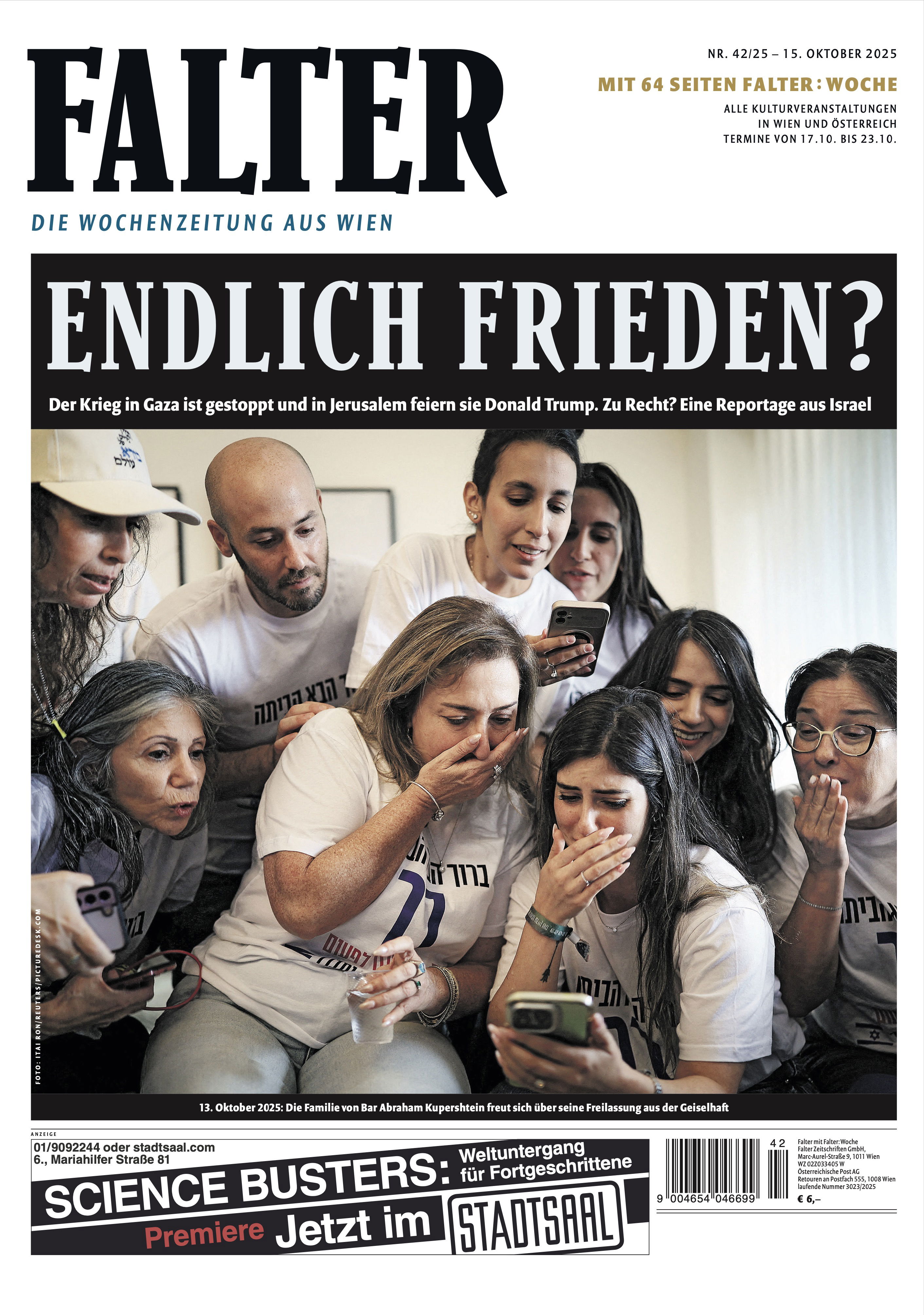
Der Hund fällt nicht weit vom Stammbaum
Viktoria Klimpfinger in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 21)
us einem Lebensalter hinauswachsen, ins nächste hineinschlittern: Coming-of-Age-Geschichten nehmen das Erwachsenwerden ins Visier. Dafür braucht es einen Katalysator. Das kann eine Teenager-Schwangerschaft sein wie im Filmdrama „Juno“ oder eine waghalsige Autoreise wie in Wolfgang Herrndorfs „Tschick“. In Rob Perrys Debütroman „Der Große Gary“ reicht ein ausgebüxter Windhund, um das Leben des 18-jährigen Benjamin aus den Angeln zu heben.
Auf besonders festem Fundament ruht es ohnehin nicht in dem Mobilheim in einer Wohnwagensiedlung an der Ostküste Englands, wo der 18-Jährige mit seiner Großmutter lebt. Oder gelebt hat. Seine Oma liegt im Krankenhaus, ist kaum mehr ansprechbar. Außer ihr hat Benjamin nur seine Vorgesetzte Camille im Supermarkt, die sich etwas zu sehr auf ihre Amulette und Kristalle verlässt – und seine lähmende Keimphobie.
Als Gary ihm am Strand zuläuft, registriert Benjamin zunächst nur die Schmutzpartikel im Fell und die Bakterien im Speichel. Er führt Buch darüber, was der Hund in dem von der Oma liebevoll eingerichteten Mobilheim berührt, um es danach zu desinfizieren. Gary wird zur wandelnden Desensibilisierungstherapie für Benjamin. Ebenso wie Leonard.
Der hatte den beiden nur chinesisches Essen geliefert. Aber als er Gary sieht, erkennt er in ihm den berühmten Rennhund, von dem er in der Zeitung gelesen hat. Garys Besitzer suchen nach ihm – dubiose Kerle, die vor Gewalt nicht zurückschrecken. Auch Leonard ist nicht unbedingt ein Typ, zu dem man ohne Vorbehalte ins Auto steigen würde. Zwielichtig, flapsig, ungepflegt. Aber er ist der Einzige, der da ist.
Was folgt, ist eine Mischung aus Robinsonade und Roadmovie. Benjamin, Leonard und Gary verstecken sich zunächst in Leonards schimmeligem Mobilheim auf einer Klippe, während auch noch ein globales Virus über den Horizont kriecht. Dann kommt, was kommen muss: Verrat, Enttäuschung und ein paar Schlägereien.
Die Geschichte braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Aber sobald sie Fahrt aufnimmt, will man nicht mehr anhalten. Bei aller Nüchternheit, die der Erzählperspektive eines verschlossenen Teenagers entspricht, scheut der Autor nicht die großen Gefühle, und wenn Benjamin im Spital verzweifelt nach seiner Oma sucht, verzweifelt man mit ihm.
Ruhig und ergreifend schildert Perry, wie die Trauer sich allmählich in den Hirnwindungen einnistet und wartet. Er erzählt darüber hinaus von einer tiefen Verbundenheit, die ohne Worte auskommt – und vom Mut, den man lernen kann.
Dass der Autor Hundebesitzer ist, merkt man an der präzisen Beschreibung von Garys Verhalten, die freilich sparsam eingesetzt ist. In der Erzählung nimmt der Hund selbst verhältnismäßig wenig Raum ein, ganz so, als würde es sich Perry nicht anmaßen wollen, Annahmen über Garys Innenleben anzustellen. Es bleibt beim Staunen, etwa darüber, wie dieser im gestreckten Galopp über ein Stoppelfeld zu schweben scheint.
Hunde finden sich in der Literatur zuhauf: tragische wie Marie von Ebner-Eschenbachs „Krambambuli“ oder komödiantische wie in Ernst Jandls monovokalem Gedicht, in dem „ottos mops“ hopst, trotzt – und kotzt. Thomas Manns „Herr und Hund“ machte seinen Hund Bauschan so berühmt, dass er Kondolenzschreiben erhielt, als dieser starb. Alice Herdan-Zuckmayer widmete dem unverhofft geerbten Familienhund die Erzählung „Das Scheusal“, die zeigt, wie einem Hunde unweigerlich ans Herz wachsen. Gertrude Stein schließlich haben wir den treffenden Satz zu verdanken: „Ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt.“
In „Der Große Gary“ wird der Hund weder vermenschlicht noch ausführlich charakterisiert. Es reicht, dass er da ist und sich im richtigen Moment an Benjamins Seite schmiegt. Hundehalter kennen das Gefühl. Aber selbst wer es nicht kennt, könnte am Ende heulen wie ein Schlosshund.