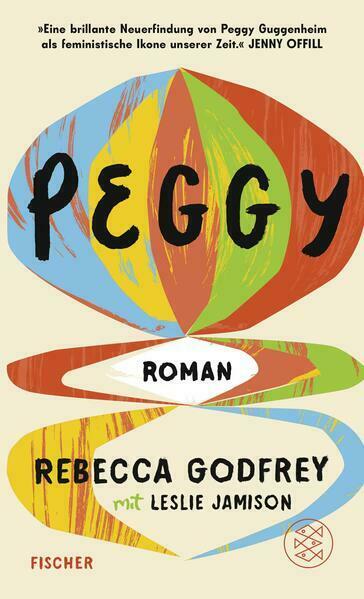In den Federn mit „Sam“ Beckett
Nicole Scheyerer in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 10)
Zehn Jahre lang arbeitete die kanadische Autorin Rebecca Godfrey an ihrer Romanbiografie über die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim (1898–1979). Von eigensinnigen Frauenfiguren hatten schon ihre erfolgreichen Romane „The Torn Skirt“ (2001) und „Under the Bridge“ (2005) erzählt, aber „Peggy“ geriet zur Tour de Force.
2018 erkrankte Godfrey an Lungenkrebs. Während der vier Jahre bis zu ihrem Tod schrieb sie über Guggenheims von Gefühlskälte bestimmte Jugend und über die Gewalterfahrung in ihrer ersten Ehe. „Gib ihr diesen dritten Teil, etwas Glück und Triumph“, bat die 54-Jährige im Krankenhaus ihre Freundin, die Schriftstellerin Leslie Jamison.
In einem Essay für den New Yorker schreibt Jamison, dass sie auf die Frage, ob sie das Buch vollenden würde, sofort zusagte. Die US-Schriftstellerin wurde 2016 mit dem Essayband „Die Empathie-Tests“ bekannt, und auch ihr im Vorjahr erschienenes Memoir „Splitter“ über Mutterschaft und Trennung erntete viel Lob.
Nun herrscht wahrlich kein Mangel an Schmökern über die New Yorker Millionenerbin und Museumsgründerin. Seit ihrer amüsanten Autobiografie „Confessions of an Art Addict“ von 1946 sind locker ein Dutzend Sachbücher und Romane über die Kunstbesessene erschienen – jüngst sogar Schmonzetten mit Untertiteln wie „Der Traum vom Glück“ oder „Sie lebte die Liebe und veränderte die Welt der Kunst“.
„Ich bin die Tochter zweier Dynastien; ich gelte als reicher als der Rest der Stadt, übertroffen nur von unserem Nachbarn, Rockefeller.“ In erster Person und flottem Tonfall schildert Peggy im Prolog, wie ihre Großväter als arme Burschen aus deutschen Landen nach Amerika kamen und sich von „Teilachern“ (Jiddisch für „Hausierer“) zu Industriemagnaten und Bankiers hocharbeiteten.
Trotz ihrer gigantischen Vermögen müssen die jüdischen Aufsteigerfamilien weiter um ihre Anerkennung kämpfen. Eine Bar Mitzwa fehlt im Buch, alles dreht sich um den Debütantinnenball. Nach dem Willen der resoluten Mutter sollen die Töchter Benita, Peggy und Hazel nichts anderes als eine gute Partie machen. Die Stärke des Romans liegt darin, dass er weniger die Psyche seiner Heldin als die familiären und gesellschaftlichen Umstände ausleuchtet. Gelungene Szenen belegen Peggys Exzentrik, etwa deren Vorliebe, auf einem Raubtierfell liegend zu lesen. „Lass vom Tiger ab und steh vom Boden auf!“, befiehlt Frau Mama stets. Die Weisung wird später zum inneren Mantra der Tochter, wenn es gilt, sich von dem Brutalo Laurence Vail zu lösen.
Dass der Vater ein Lotterleben in Paris führt, dort seine Millionen durchbringt und schließlich mit der Titanic untergeht, wirft einen Schatten auf das Leben seiner Töchter, von denen zwei tragisch enden. Beim Tod ihres Daddy ist Peggy erst 14; ihr Leben lang wird sie ihn zum schöngeistigen Visionär verklären – ein schlechtes Fundament für die Partnerwahl, das dem Beuteschema „genialer Schriftsteller mit Schreibblockade“ folgt.
Dennoch findet die Protagonistin im letzten Teil des Romans auftragsgemäß etwas Happiness. Witzig: „Sam“ Beckett kugelt lieber mit Peggy im Bett herum, als für James Joyce den Gehilfen zu machen oder sich hinter die Schreibmaschine zu klemmen. Allerdings scheint auch die angehende Galeristin Guggenheim, die extravagante Ausstellungen plant, weniger an Kunst als an Liebesnächten interessiert.
Dass er von vier Händen stammt, merkt man dem 400-Seiter nicht an. Die Bio endet 1938 mit Peggys glanzvoller Eröffnung der Londoner Galerie Guggenheim Jeune und führt im Epilog nach Venedig, wo die Millionärin 1958 im Palazzo Venier residiert, der heute ihr Museum beherbergt. So kurzweilig, wie diese Lebensgeschichte Komik und Tragik austariert, folgt man ihr gerne bis zum Schluss.