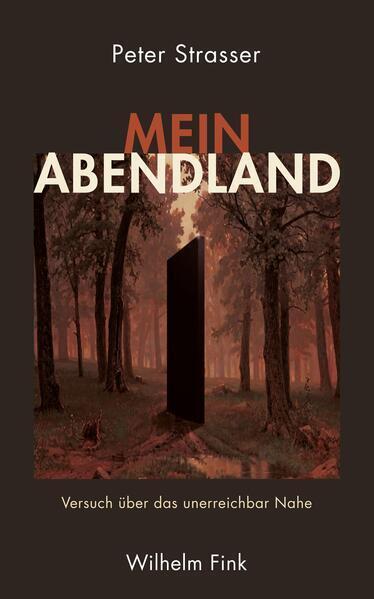Vom Alltag bis zum Abendland
Thomas Leitner in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 45)
Philosophie: Peter Strasser zählt zu den produktivsten Philosophen. Im Frühjahr erscheinen zwei Bücher
Peter Strasser, Jahrgang 1950, lehrte in Graz und Klagenfurt. Einige Jahre lang fungierte er als Beirat des Steirischen Herbstes, war mit Thomas Macho Herausgeber der Schriftenreihe „Bibliothek der Unruhe und des Bewahrens“ und bis vor kurzem Mitglied des Autorenkollektivs von Tumult, der – wie sie sich selbst bezeichnet – „Vierteljahreszeitschrift für Konsensstörung“. 2014 erhielt er den Staatspreis für Kulturpublizistik.
Einer breiteren Öffentlichkeit ist seine wöchentliche Glosse in der Tageszeitung Die Presse bekannt, die er von 2003 bis 2013 unter dem Titel „Die vorletzten Dinge“ veröffentlichte. Bis zu seiner Emeritierung im letzten Jahr war Peter Strasser Professor für Philosophie an der Juridischen Fakultät der Karl Franzens-Universität. Dort, vor allem aber als Publizist, ist er weiterhin sehr aktiv –im vergangenen Jahr erschienen vier Bücher, und im Frühjahrsprogramm 2017 ist Strasser schon wieder mit zwei Werken vertreten.
Traumfetzen und Tagesform
„Morgengrauen“ setzt sich, wie schon mancher Band davor, aus Kolumnen zusammen, die Strasser zunächst in der NZZ publiziert hatte. Wie der Titel andeutet, wird der Leser Zeuge des allmorgendlichen, meist mühsamen Herantastens eines nicht mehr ganz jungen Philosophen an den privaten, zunächst grau – wenn nicht grausig – erscheinenden Alltag.
Traumfetzen der Nacht wirken da nach, in die das Philosophenhirn die abendländische Tradition hineinwirkt, Reflexionen aus einer weiter und politischer gefassten, über den Frühstückstisch hinaus- bzw. aus dem Allgemeinen hereinwirkenden Wirklichkeit stellen sich ein. Das Gelingen des „Unternehmens“, das sich anschließend in schriftlicher Form in der Kolumne niederschlägt, hängt von der jeweiligen Tagesform ab.
Der Leser wird zum Zeugen, wie aus dem scheinbaren Nichts eine ihr Ziel treffende Polemik erblüht: Wenn etwa Schlüsse von der „Pitbullästhetik“ des Schmuckes der ehemaligen „Frau Innenminister“ bei einer Grenzlandinspektion auf das Ende der „Willkommenskulturpolitik“ gezogen werden, ist das gemein, aber fein.
Manchmal werden Tief- und Unsinn von Floskeln der Alltagssprache oder Schlagwörtern der Medienöffentlichkeit so aneinandergerieben, dass es wie in einem Karl-Kraus’schen Aphorismus scharf aufblitzt. In der so bekannten wie banalen Situation eines langen Wartens auf den Bus in der Kälte entwickelt sich aus der Ungeduld und dem Sich-beschweren-Wollen ein Sprachgewitter: eine Reflexion des Philosophen über seine Situation des steten „zu früh“ und „zu spät“.
In manchen Passagen stellt sich durch die hohe Kalauerdichte Ermüdung ein – immer aber vergnügt den Leser die Formulierungslust des Autors.
Schreibrituale und Abstoßungen
Die Wiederkehr einiger Leitmotive zeigt, dass das morgendliche Schreibritual kein bloßer Selbstzweck ist, sondern die Praxis eines Philosophen, der seine Themen permanent mit dem Erzählen des eigenen Alltags verknüpft. Die Rezeptionsgeschichte – wenn man Leserbriefe so hochtrabend bezeichnen will – hat gezeigt, dass diese Vorgangsweise viele Bewunderer findet, manch einer darauf aber allergisch reagiert.
Ein Teil des Publikums zeigt diese Abstoßungsreaktion, weil es eine gewisse akademische Würde vermisst, die man auch Bierernst nennen könnte. Andere reagieren aus schlichter Geistfeindlichkeit so. Beides wohl erfreut den Autor. Der Anstoß, den das Alltagsbewusstsein von ihm in aller Herrgottsfrüh bekommt, stammt oft aus einem Teilgebiet von Strassers breitgefächertem Interessenfeld.
Auf unterschiedlichem Anspruchsniveau, von der Zeitungskolumne über populärwissenschaftliche Publikationen bis hin zur fachphilosophischen Abhandlung hat sich in 40 Jahren und über 50 Buchpublikationen allerlei angesammelt: Religionsphilosophie trifft auf Moraltheologie, Rechtstheorie auf Kriminalsoziologie, Kultur- auf Medienkritik und nicht zuletzt Erkenntnistheorie auf ontologisches Interesse.
Das „Journal zum philosophischen Hausgebrauch“, wie Peter Strasser seine Kolumnensammlung im Untertitel nennt, hat ihn dazu angeregt, darin immer wieder auftauchende Leitmotive aufeinander abzustimmen und sie sich erläuternd gegenüberzustellen.
Was ist der Westen?
Entstanden ist daraus das Kompendium „Mein Abendland“: In diesem „Parallelbuch“ schält Strasser den Tenor seiner Einzelbeobachtungen verdichtend heraus und treibt ihn in vier Kapiteln kontrastierend weiter. Sein „Versuch über das unerreichbare Nahe“ – so der Untertitel hier – ist im Wesentlichen eine Verteidigung seines speziellen Abendlandes, zunächst und vor allem gegen jene anderen Verteidiger des Westens, die sich in der Bewahrung einer herbeifantasierten Identität bestätigen wollen.
In der ersten Hälfte des Buches überwiegen die Stellungnahmen zum aktuellen Tagesgeschehen. Dämonen wurden geweckt durch die Fluchtbewegung der letzten Jahre, sie bringen das dem Christentum entsprungene und durch die Aufklärung verallgemeinerte Gefühl der Verpflichtung zur Barmherzigkeit ins Wanken. Abgedroschene Phrasen vom christlichen Abendland dienen nun als Waffen in der Arena eines heillosen ideologischen Getümmels.
„Abendlandisieren“ nennt Peter Strasser diese „verwilderte Form des Selbstseinwollens“. Infolgedessen teilt er Kants späten Verdacht, der Mensch neige – unbegreiflich für die Vernunft – dazu, wider besseres Wissen und Gewissen „böse Maximen“ als Richtlinie eigenen Handelns zu wählen.
Zur Zähmung des „radical Bösen“ (den Terminus entlehnt er von Kant, der für diesen von seinem König und Goethe grob gescholten worden war!) sowie zur Widerlegung der Wir-sind-das-Volk-Schreier und auch der „Entwurzelten“, für die mit Oswald Spengler das Abendland längst schon untergegangen ist, entwirft Strasser eine geistige Geografie des Gebietes, für das sich gerne sagen lässt: „Hier ist der Westen.“
Das Kapitel mit diesem Titel bildet das Kernstück seines politischen Anliegens, er entwickelt es in neun Thesen. Universalität, Toleranz, Trennung von Recht und Moral bzw. von weltlicher und religiöser Moral, Verfassungspatriotismus, Förderung und Bewahrung von kultureller Vielfalt, Eindämmung der Furcht vor dem Fremden, Integration durch Partizipation sind die Leitideen des anzustrebenden Westens.
Aus diesen, so hofft er, kann eine Gesellschaft entspringen, in der alle Menschen vor der Furcht vor Grausamkeit geschützt werden (hier übernimmt Strasser die Abwandlung einer Kant’schen These von Judith N. Shklar). So wenig neu das Programm ist und auch wenn es von notorischen Nörglern als „Geklapper universalistischer Gebetsmühlen“ abgetan werden kann: Ihre Einhaltung ist unabdingbar, wenn der Westen Westen und als solcher wünschenswert bleiben soll.
Zeitgeschehen und Denkmögliches
In der Folge wird das Werk dunkler, vielschichtiger und fordernder. Höhenflug und Tiefgang sind da so eng geführt, dass dem Tempo und Wegstrecke nachvollziehenden Leser ein wenig schwindeln kann. Materialistischer Reduktionismus wird in seine Aporien geführt, der Schöpfungsgedanke nie ganz aufgegeben. Obwohl dem Leser von Urknalltheorie und dem Kampf von Teilchen und Antiteilchen der Kopf schwirrt, erhellt sich sein Gemüt durch die Art, wie der Autor für das erkenntnistheoretische Problem als Bild ein Goethe-Zitat herannimmt: „Wär nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken.“
Eine starke Seite des aphoristischen Stils ist übrigens die Eleganz, mit der Literatur und Kunst zum Bei-Spielen gebracht werden: ein Holbein-Bild kommentiert die (Un-?)Möglichkeit der Auferstehung, Doderer-Passagen bilden Auftakt und Nachklang des Buches. Strasser verortet sich als Philosoph der europäischen Tradition, für die bei aller Emanzipation von Religion das metaphysische Interesse nie obsolet wird.
Das Erbe des Deutschen Idealismus mit seiner Geistesphilosophie der Subjekt-Objekt-Bewegung bleibt die Heimat, ein „Land ort-loser Sehnsucht“. So wird aus dem Text, der sich zunächst als Kommentar zum Zeitgeschehen liest, in seiner Entwicklung ein genuin philosophisches Werk, das aus einem voraussetzungslosen Grundgedanken tendenziell die Totalität des Denkmöglichen enthält und dennoch immer den Bezug zur Lebenspraxis des Subjekts im Blick behält.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: