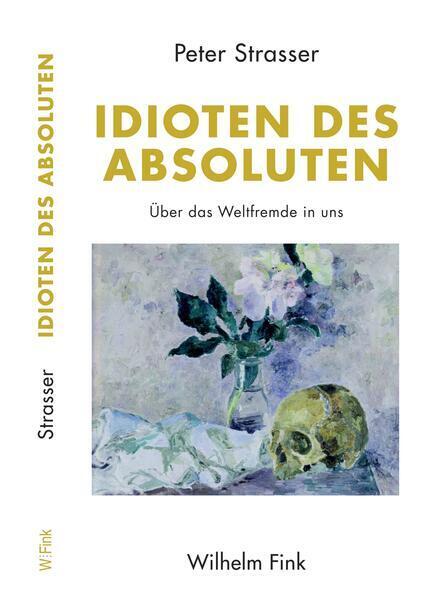„Der Osterhase ist der Buddha des Westens“
Klaus Nüchtern in FALTER 51-52/2017 vom 20.12.2017 (S. 38)
Der Philosoph Peter Strasser ist „irgendwie religiös“ und meint das ernst. Ein weihnachtliches Gespräch über die Geborgenheit im Schlechten, die Hölle und den lieben Gott
Schon in seinem „Journal der letzten Dinge“ (1998) beschäftigte den österreichischen Philosophen Peter Strasser „die paradox anmutende Frage, was es unter der Voraussetzung des Unglaubens bedeutet, zu den Tatsachen des Lebens eine religiöse Haltung einzunehmen“. 27 Publikationen später (wir halten uns an die Bibliografie auf Wikipedia), die sich u.a. um „Große Gefühle“, um „Sehnsucht“, „Unschuld“, „Ratlosigkeit“ oder „Mein Abendland“ drehten, beschäftigt Strasser diese Frage erneut.
In „Idioten des Absoluten“ geht Strasser zwar nicht so weit wie der frisch zum Christentum bekehrte Bob Dylan, der die Hand des Meisters noch in jedem zitternden Blatt und Sandkorn sehen konnte („Every Grain of Sand“), aber er kommt ihm doch sehr nahe: „Noch im unscheinbarsten Ding, selbst noch im Sandkorn der Wüste aus Myriaden von Sandkörnern, leuchtet auf, dass es, dieses eine einmalige Sandkorn, ist und nicht vielmehr nicht ist.“ Und Strasser scheut nicht davor zurück, vom „Wunder der Schöpfung“ zu sprechen. Das folgende Interview wurde auf Wunsch Strassers per E-Mail geführt.
Falter: Es gibt eine Tradition in der analytischen Philosophie, die alle Metaphysik als unzulässige Spekulation abtut, und analog dazu eine weltanschauliche Position, die auf einer „illusionslosen“ Innerweltlichkeit beharrt. Sie sehen das anders?
Peter Strasser: Also den Ingrimm meines Lehrers Ernst Topitsch, der „Vom Ursprung und Ende der Metaphysik“ schrieb, hab ich noch gut verstanden. Der musste unter den Wiener Nachkriegsverhältnissen an der Uni malochen, wo ein katholischer Hegelianismus hoch im Kurs stand. Aber heute? Gerade ist ein Buch erschienen, Sachbuch, Bestseller, das den alarmierenden Titel „Homo Deus“ trägt. Der Mensch will Maschine werden, unsterblich und Gott. Ich hingegen habe gerade meine alten Orchideenstöcke, die jetzt, vor Weihnachten, wieder zur großen Blüte rüsten, gepflegt und – bewundert. Die sind ein Wunder, auch wenn sie seit dem Urknall zu mir unterwegs sind und aus dem Quantenvakuum emporsprießen sollten. Ja, dann erst recht! Wer angesichts solcher Mysterien von einer illusionslosen Innerweltlichkeit schwafelt – der ist kein Philosoph, sondern ein Depp. Na schön, sagen wir, ein philosophischer Depp.
Das erinnert ein wenig an Robert Musils „Schwärmer“, in denen Thomas meint, das „menschlichste Geheimnis der Musik“ bestünde darin, „dass es mit Hilfe eines getrockneten Schafsdarmes gelingt, uns Gott nahe zu bringen“. Gibt es so etwas wie eine Gottesvorstellung für Agnostiker oder sogar Atheisten?
Strasser: Also das saftige Wunder meiner Orchideenstöcke mit einem getrockneten Schafsdarm in Verbindung zu bringen, ich weiß nicht … Sei’s drum, Musil ist ein interessanter Fall, ein mystisches Bleichgesicht sozusagen. Im zweiten Band vom „Mann ohne Eigenschaften“ schaukeln der eigenschaftslose Mann und seine Schwester viele Seiten lang in der Hängematte des Gartens, um über Mystik zu palavern. Dabei kommt nix heraus. Jedenfalls keine Gottesvorstellung. Aber alles kreist um das, was die Mystikfraktion gerne als „moment of being“ bezeichnet, jenen zeitlosen Moment, in dem sich begriffslos „Alles“ offenbart, während das endliche Ich verschwindet. Das ist die Schrumpfform einer Gottesvorstellung, aber zugleich der Versuch, die Welt metaphysisch offenzuhalten. Für den im engeren Sinne Gläubigen grenzt das schon an Agnostizismus. Wobei der kluge Agnostiker seinerseits weiß, dass der Atheist sich gerne über eine Gottesvorstellung mokiert, die kein einigermaßen aufgeklärter Mensch wörtlich nehmen würde. Für den Atheisten muss es der alte Mann über den Wolken mit dem langen weißen Bart sein! Mit solchen Leuten zu debattieren ist irgendwie witzlos.
Sie schreiben, dass es in unserem „modernen“ Weltbild keinen Platz mehr für den Himmel gebe …
Strasser: Die Menschen haben zu allen Zeiten alle Scheußlichkeiten der Welt durchexerziert, ohne sich von der Vorstellung abhalten zu lassen, deswegen nicht im Paradies zu landen und mit Kamelen, Jungfrauen und Datteln belohnt zu werden. Für so was Feines, aber Fernes wird man nicht lammfromm und hochmoralisch. Für so was sprengt man sich als Gotteskrieger in die Luft, und zwar, um ein paar Ungläubige mit in den Tod und damit in die ewige Verdammnis zu reißen. Denn es sind offenbar die Leichen der Glaubensfeinde, die den allergütigsten Gott erst so recht gütig gegenüber den seinen stimmen. Da gibt es eine ziemlich unheimliche Dialektik.
Ich muss Ihren Satz noch zu Ende zitieren: kein Platz für den Himmel „und für die Hölle – leider – schon gar nicht“. Woher kommt dieses Bedauern?
Strasser: Weil die Bösewichte, die in einer religiösen Vorstellungswelt leben, sich höchstens durch ihre Angst vor dem ewigen Höllenfeuer ein wenig zügeln lassen. Höchstens! Vor allem aber ist der Gedanke befriedigend, dass die allerschlimmsten Schurken, die Menschenquäler und Menschenschlächter, die hierorts womöglich friedlich im Bett ihr hassenswertes Leben aushauchen, dann immerhin vom Teufel und seinen Folterknechten erwartet werden. Sorry, ich weiß, das klingt nicht sehr christlich.
Braucht es auch nicht, aber die Gretchenfrage kann ich Ihnen jetzt doch nicht ersparen. Sie sehen es vermutlich „philosophisch“ und das heißt dann wohl: irgendwie pro Transzendenz, aber ohne Glaubensbekenntnis.
Strasser: „Irgendwie pro Transzendenz“, das klingt so wischiwaschi, das kann ich, philosophisch gesehen, unbedingt gelten lassen.
Das ist jetzt ein bissl kokett. Außerdem versuchen Sie sich um die Frage zu drücken. Wie also halten Sie’s mit der Religion?
Strasser: Wenn Sie diese Frage so meinen wie das tiefgläubige und naive Gretchen, das sich Faust hingeben möchte, dann kommt sie mir ein wenig inquisitorisch vor. Falls wir jetzt über „Sexualität und Begehren“ diskutierten, weil ich ein Buch zu diesem Thema geschrieben hätte, würden Sie mich dann nach meiner sexuellen Ausrichtung fragen? Vermutlich käme Ihnen das indezent vor.
Das käme aufs Buch an. In dem Buch, über das wir tatsächlich sprechen, haben Sie jedenfalls dem „modernen Realisten“, wie Sie ihn nennen, vorgehalten, Gott und den Osterhasen „derselben Wirklichkeit zuzuschlagen“, dann interessiert es mich als naive und indezente Gretl naturgemäß, in welcher Wirklichkeit für Sie Gott zu Hause ist.
Strasser: Ich hab nichts gegen Leute, die glauben, sich outen zu sollen. Aber ich denke auch, dass ich das Recht habe, mich derartig persönlichen Fragen zu entziehen. Sei’s drum. Ich bin konfessionell ungebunden, bete nicht, bin kein Kirchgänger und würde trotzdem kaum zögern, mich als „irgendwie religiösen Menschen“ zu bezeichnen. Manchmal werde ich gefragt, ob ich an Gott glaube, und darauf kann ich nicht einmal antworten: „Irgendwie.“ Denn das Problem der Existenz Gottes ist nicht das Problem seiner Existenz, sondern des Umstandes, dass ich nicht weiß, was, abstrakt gesprochen, der Begriff „Gott“ bedeutet.
„Irgendwie religiös“, aber lieber ohne Gott: Da kann man dann doch gleich Yogitee trinken und einen auf „spirituell“ machen?
Strasser: Na ja, „irgendwie religiös“ klingt tatsächlich so, als ob die klassische Gottesdefinition – Gott ist das vollkommenste Wesen, über das hinaus sich kein größeres denken lässt – „spirituell“ verdünnt worden wäre. Die professorale Geistesgröße in Heinrich Bölls Erzählung „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ (siehe auch den Artikel zu Bölls 100. Geburtstag auf S. 44, Red.) besteht darauf, das Wort „Gott“ durch die Wendung „jenes höhere Wesen, das wir verehren“ zu ersetzen. Das macht seinen Radiovortrag nicht besser, nur länger. Doch die Pointe ist, dass alle recht haben, Sie auch, denn wir reden ja über unser kleinmenschliches Verhältnis zum Absoluten. Und was den Osterhasen betrifft, den mag ich nicht nur meiner reizenden Enkeltöchter wegen. Der Osterhase ist der Buddha des Westens, sein Geheimnis ist es, grinsend keines zu haben, nicht aber, ohne Haken zu schlagen …
Es gibt viele Leute, die zwar nicht an Gott glauben, aber sich daran stoßen, wenn dieser gleichsam „kleingeredet“ wird. Müsste nicht eigentlich jeder echte Gottesglaube Religion ausschließen? Es ist doch anmaßend, mit dem Absoluten in Kommunikation treten, es verstehen oder gar Wünsche an es richten zu wollen?
Strasser: Ich komme, wie man gerne beschönigend sagt, aus kleinen Verhältnissen, und der Gott der kleinen Leute hat etwas Tröstliches: Mit ihm lässt sich reden. Meine Großmutter ging nicht zur Kirche, glaubte aber an den lieben Gott und daran, dass sie in den Himmel kommen wird (sie musste viel leiden). Meine Mutter glaubte an Engel, außerdem hatte sie ein scheu-romantisches Verhältnis zu den Männern Gottes. Ich hingegen hatte das unbeschreibliche Privileg, die Mittelschule besuchen und studieren zu dürfen, und natürlich revoltierte ich bald gegen den „Aberglauben“. Der Vorwurf, die Religion homöopathisch zu verdünnen, wurde mir später von ignoranten Typen gemacht, die nicht wissen, dass ich noch immer den „lieben Gott“ in meinem Kinderherzen trage. Er ist es wohl, der mich „irgendwie religiös“ sein lässt. In das Gefühl der Weltfremdheit mischt sich eine Art Geborgenheit im Schlechten – ich kann das nicht besser sagen.
Aber zugleich argumentieren Sie in Ihrem Buch, dass diese Geborgenheit in einer Welt, die einem notwendig auch fremd ist, eben nicht einfach ein subjektives Gefühl, sondern Bestandteil der Conditio humana ist?
Strasser: Kaum legt man den Finger auf Begriffe wie Conditio humana, schon wird einem schwindlig. Wittgenstein berichtet, dass er während einer Aufführung des Anzengruber-Stückes „Die Kreuzelschreiber“ plötzlich von der Gewissheit überwältigt wurde: „Was auch immer passiert, mir kann nichts passieren!“ Im Stück erfährt diese Gewissheit eine Figur, der Steinklopferhanns, Sohn einer Dienstmagd. Wenn ich auf das persönliche, ja persönlichste Moment in der Glaubensessenz hinweise, sage ich eigentlich gar nichts Neues. Entweder man ist bereit, vor dem Absoluten zu kapitulieren, sich ihm kompromisslos auszuliefern, gegen jede Vernunft, dann ist das die religiöse Einstellung. Alles andere beläuft sich auf ein ständiges Hadern und Flehen und schlaues Sich-beliebt-Machen vor Gott angesichts einer Welt, von der E.M. Cioran sagt, sie sei eine Hölle voller Wunder. Doch ich denke, dass eben dieses allerpersönlichste Moment des Geborgenseins in einer Welt, die man als moralisches Wesen großenteils ablehnen und bekämpfen sollte und deren Geheimnis uns doch zur höchsten, tiefsten, lebenslangen Liebe anzustacheln vermag … dass also eben dieses im Grunde idiotische Einverständnis – ja was? Darf ich sagen: uns allen in die Seele gelegt ist, die es angeblich gar nicht gibt? Wir alle sind eben Idioten des Absoluten.
Vielleicht können Sie mir, bevor wir auf die letzten Dinge zu sprechen kommen, erklären, warum alle an diesem Cioran einen Narren gefressen haben? Ist der nicht insgesamt doch ein recht halbseidener Bonmot-Manufakteur? Wobei das von Ihnen zitierte zugegebenermaßen eins der Besseren ist.
Strasser: Warum „alle“? Sie sind doch schon einer, der den Cioran nicht verputzen kann, und ich würde mich Ihnen gerne anschließen. Trotz des Zitats. Vor einem Menschen, der nicht begriffen hat, dass die Wunder dieser Welt, die man lobpreisen möchte, am Grund einer Hölle spielen – also vor so einem tät ich mich fürchten. Cioran ist eine Art Paulo Coelho für Querdenker, ein geistiger Maulheld der Apokalypse – ungefähr so, wie die Anhänger des Coelho das Leben schönreden, ohne einen Finger zu rühren, um es erträglich zu machen, besonders für jene Ärmsten der Armen, denen die Welt tatsächlich als Hölle erscheinen muss.
Bleiben wir gleich einmal bei denen. Woher soll ein Kind, das, sagen wir, als Waise im Bürgerkrieg aufwächst, zu einem Weltvertrauen oder einem Geborgenheitsgefühl kommen?
Strasser: Sie beschämen den Philosophen in mir, der sich womöglich ein „Welteinverständnis“ herbeischreibt, eines, das vor den Tatsachen keinen Bestand – und keine Berechtigung – hat. Aber ich selbst habe als Kind infolge einer schweren Krankheit eine Zeit größtmöglicher Einsamkeit erlebt. Verzweiflung wohl auch. Dann, eines Tages, nach meiner Rückkehr nach Hause, gab es diesen einen langen Moment: „Es ist, wie es ist, und es ist gut.“ Schön, da war ein Gefühl großer Erleichterung mit im Spiel, aber es wurde mir auch etwas darüber hinaus Liegendes offeriert, etwas, das über alle Psychologie hinausging. Im Rückblick erscheint mir meine höchstpersönliche „Zeit in der Hölle“ in einer fernen Lungenheilanstalt als Teil meines Schicksals auf Erden; als etwas, das mich nicht mit der Welt versöhnt und trotzdem das meine ist. Der Gedanke, dass alles, was mir passiert, mir auch zugedacht sei, hat mich seither niemals mehr ganz verlassen. Ja, er hat mich dazu bewogen, mein Leben unter diesem Aspekt zu sehen. Das ergibt, ich kann mir nicht helfen, eine „irgendwie religiöse“ Sicht der Dinge.
Und wie genau meinten Sie es, dass man das Moment der Weltgeborgenheit „als moralisches Wesen“ bekämpfen solle?
Weil jenes Moment träge und blind macht für das Leid der anderen?
Strasser: Das menschliche Leben, das immer auch ein ethisch gefordertes ist, unterliegt meines Erachtens einer paradoxen Regel: Vermeide und bekämpfe das Böse, malum est vitandum. Zugleich aber soll man sich bemühen, die Wahrheit des Satzes „Es ist, wie es ist, und es ist gut“ nicht zu verraten – im Namen welcher Ethik, welcher Humanitätsemphase auch immer!