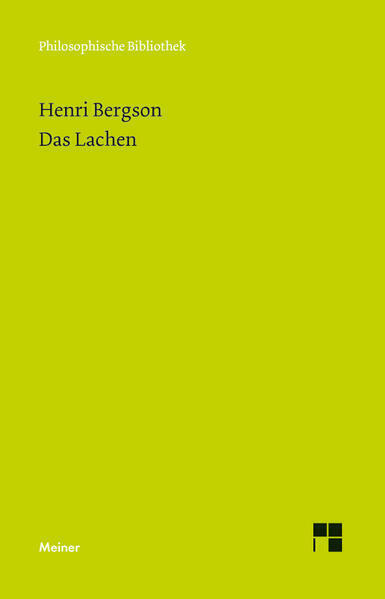Zum Lachen braucht es ein wenig Geist
Klaus Nüchtern in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 49)
Philosophie: Henri Bergsons Klassiker "Das Lachen" hat seit Erscheinen wenig Konkurrenz bekommen
"Zum Lachen", meinte Gottfried Keller, "braucht es immer ein wenig Geist. Das Tier lacht nicht." Die jüngsten Forschungsergebnisse scheinen den Dichter zu bestätigen. Der amerikanische Kognitionspsychologe Matthew Hurley, der gemeinsam mit seinem Kollegen Reginald Adams und dem Philosophen Daniel Dennett eine Theorie des Humors vorgelegt hat ("Inside Jokes: Using Humor to Reverse-Engineer the Mind", 2011), geht davon aus, dass alle Witze auf die gleiche Weise geistig verarbeitet werden: Eine Annahme, zu der uns die Witze verleiten, stellt sich als falsch heraus, und "Heiterkeit und Lachen sind die Belohnung für diese Korrektur", sagte er jüngst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.
Angesichts der anthropologischen Bedeutung, die dem Lachen zugeschrieben wird, und der sozialen Relevanz, die es fraglos hat, ist es erstaunlich, wie wenig Anstrengungen unternommen worden sind, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen – weswegen ein Klassiker wie "Das Lachen", Henri Bergsons "Essay über die Bedeutung des Komischen" (orig. 1900, dt. erstmals 1921), schon wegen mangelnder Konkurrenz in Umlauf bleibt.
Soeben hat der Meiner Verlag das Werk wiederaufgelegt, und zwar in der 1972 bei Arche erschienenen, aber mittlerweile vergriffenen Übersetzung von Roswitha Plancherel-Walter, die auf der 23. Auflage von 1924 basiert. Im Nachwort zu dieser erhebt Bergson (1859–1941) den Anspruch, seine Definition des Komischen im Unterschied zu den zahlreichen und meist zu weit gefassten anderen aus Anschauungsmaterial (vor allem den Komödien eines Molière oder Labiche) abgeleitet zu haben.
Und betont den kognitiven Aspekt der Komik: "Die Komik bedarf (
) einer vorübergehenden Anästhesie des Herzens, um sich voll entfalten zu können. Sie wendet sich an den reinen Intellekt." Die Quelle der Komik aber ist eine Ähnlichkeit zwischen Menschlichem und Mechanischem – weswegen Kinderspielzeug wie Hampelmann oder Springteufel für Bergson auch zu so etwas wie Prototypen des Komischen werden: "Wir lachen immer dann, wenn eine Person uns an ein Ding erinnert."
Auf der Ebene der Pantomime oder des Marionettentheaters ist das leicht nachvollziehbar, und auch die Komödie lässt sich einigermaßen überzeugend als Genre begreifen, das mit (Stereo-)Typen arbeitet. Spätestens bei der Wortkomik, die auf das "Steife (
) in der Sprache", also den Einsatz phrasenhafter Wendungen zurückgeführt wird, büßt dieser Ansatz aber einiges an Plausibilität ein: Mit den Filmen der Marx-Brothers war Bergson, obwohl es sich biografisch ausgegangen wäre, offenbar nicht so vertraut.
Am fragwürdigsten mutet heute freilich die soziale Funktion an, die Bergson dem Lachen zuschreibt. Die Gesellschaft erscheint hier als eine Art Meta-Subjekt, das eisern über das Gebot permanenter Selbstoptimierung wacht: "(
) jede Versteifung des Charakters, des Geistes und sogar des Körpers wird der Gesellschaft daher verdächtig sein, weil sie auf eine erlahmende Tatkraft schließen lässt".
Im Gegensatz zu Hurleys These vom Lachen als "Belohnung" für die Korrektur einer falschen Hypothese, zu der uns der Witz verführt hat, ist Bergsons Lachen die Korrektur selbst – "eine soziale Geste", mit der die Gesellschaft Blockaden "an der Oberfläche des sozialen Körpers" zu beheben trachtet und die in den Trott der Gewohnheiten verfallenen Individuen wieder auf Vordermann bringt: "Durch ihr Gelächter rächt sich die Gesellschaft für die Freiheiten, die man sich ihr gegenüber genommen hat."
Eine solche Auffassung wird heute, da die Rede von der "subversiven" und "anarchischen" Kraft des Lachens fast schon zum Klischee geworden ist, auf Skepsis stoßen. Aber schon Bergson selbst mögen Zweifel ob seines sozialfunktionalistischen Ansatzes angewandelt haben. Im Schlusskapitel beteuert er, dass es "in erster Linie das Gute (war), das uns in dieser Studie beschäftigt hat". Über die Abgründe der Ambivalenz informiert man sich dann wohl besser anderswo. Zum Beispiel bei Freud. Dessen "Traumdeutung" erschien übrigens zeitgleich mit "Das Lachen": im Jahr 1900.