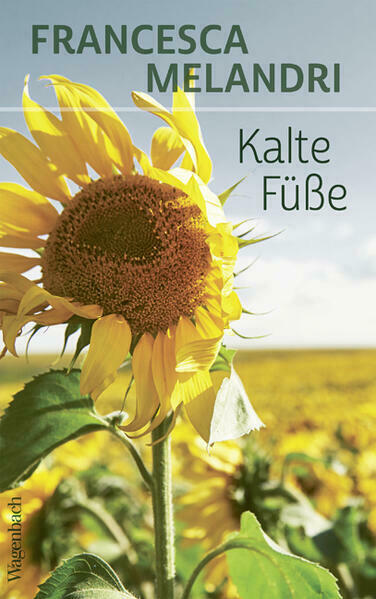Vater, komm, erzähl vom Krieg
Jutta Person in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 7)
Wer die Alpini kennt, die Gebirgsjäger des italienischen Heeres mit der Prunkfeder am Hut, der kann in etwa nachvollziehen, warum sie im Zweiten Weltkrieg von den sowjetischen Truppen als Hühner beschimpft wurden. Eine Zeit lang retteten sich die Hühner vor einem Gegenschlag, indem sie die feindliche Seite mit schaurigem, täuschend echtem Wolfsgeheul auf Abstand hielten.
So hat es der Alpini-Offizier und Journalist Franco Melandri seinen Töchtern erzählt, und dass bei solchen Kindergeschichten die Kriegsgräuel außen vor blieben, liegt auf der Hand. Familienlegenden dieser Art ließen den Vater als mutigen Davongekommenen erscheinen, als listigen Odysseus. Als „anständigen Faschisten“. Wobei die Sache mit dem Faschismus gänzlich aus dem Fokus geraten war.
Mit ihrem Roman „Alle, außer mir“ (2018) wurde Francesca Melandri international bekannt. Auch in diesem weit ausholenden Familienepos ging es um die Macht kollektiver Mythen, um die italienische Kolonialgeschichte – und um einen Vater, der keine Auskunft mehr geben kann, als ein äthiopischer Flüchtling behauptet, zur Familie zu gehören. Ihr jüngstes Buch „Kalte Füße“ dagegen ist kein Roman, sondern ein Gattungsgrenzgänger aus Memoir, Zeit-Kommentar und erinnerungspolitischem Essay.
Kalte Füße haben, ganz unmetaphorisch, die italienischen Soldaten, die beim sogenannten „Rückzug aus Russland“ in der Schneewüste starben oder mit abgefrorenen Gliedmaßen im Lazarett landeten. Die Füße des Sohnes sind es auch, die Franco Melandris Mutter nach dessen Rückkehr zuerst ansieht: Hat er noch alle Zehen? Erst dann fällt sie in Ohnmacht.
Kalte Füße zu bekommen, ist aber auch die Metapher der Stunde, wenn es um das Verhältnis des Westens zur Ukraine geht. Wer glaubt, dass der Krieg aufhört, weil man nicht weiter hinschaut, verhalte sich mindestens verantwortungslos, so die Autorin. Für sie ist diese gegenwärtige Verdrängung eng gekoppelt an viel ältere Formen der Auslöschung und des Nicht-Wissen-Wollens. Sie reichen von der jahrhundertealten, in Putins Russland fortgesetzten Unterdrückung ukrainischer Kultur und Sprache bis zur Weigerung eines beachtlichen Teils der Linken, den russisch-sowjetischen Kolonialismus als solchen wahrzunehmen. Als ob nicht auch Burjaten, Jakuten oder Ewenen bedroht waren und sind; nicht zuletzt, weil sie im Ukrainekrieg an vorderster Front verheizt werden.
Eine Anrede an den Vater zieht sich dabei als beharrliches Mantra durch das gesamte Buch: „dein Russlandfeldzug, der größtenteils ein Ukrainefeldzug war“. Denn die italienische Invasion der Jahre 1941 bis 1943 spielt sich vor allem am Donbass, in Charkiw, Sumy oder Isjum ab. Im privaten Sprachgebrauch, so Melandri, schlägt auch das Unbewusste einer Gesellschaft Wurzeln; im Familienwortschatz wiederholt sich die Nichtexistenz der Ukraine. Verschwiegen wurden aber nicht nur die ertragreichen Plünderungen dieses Feldzugs: „Dass wir selbst die Verbündeten der Nazis gewesen waren, daran wollte man lieber nicht mehr rühren.“
Neben dem verdrängten Faschismus geht es Melandri aber genauso um die Frage, ob der friedliche, reiche, mehr oder weniger unbehelligte Westen überhaupt verstehen kann, was Krieg ist. „No justice, no peace“ lautet ihre wütende Antwort an diejenigen, die nur „peace“ fordern und damit Putin, direkt oder indirekt, entgegenkämen.
Das Gegenteil von Krieg ist Rechtsstaatlichkeit, hält Melandri fest, und ihr Plädoyer ist so leidenschaftlich wie unbequem. Vor allem aber ist „Kalte Füße“ eine eindrucksvolle literarische Spurensuche nach den kleinen und großen Mythen, aus denen Überzeugungen entstehen. Ein Brief an den Vater, der die ganze Bandbreite gemischter Gefühle wiedergibt und damit etwas schafft, was meistens nur Behauptung bleibt: Privates und Politisches zusammenzudenken.