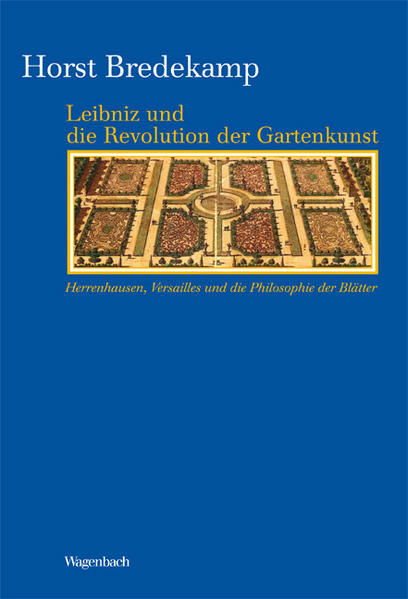Die Unterscheidbarkeit der Dinge und die Blätter
Julia Kospach in FALTER 41/2012 vom 10.10.2012 (S. 53)
Gartenkunst: Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp liest die Formensprache des Barockgartens neu
So sieht eine klassische Opposition aus: Hier die Gärten des Barock, in deren geometrischer Anlage mit den schnurgeraden Sichtachsen und akkurat geschnittenen Hecken sich der Despotismus des Ancien Régime à la Versailles ausdrückt, dem sich auch die Natur zu unterwerfen hat.
Auf der anderen Seite der Landschaftsgarten englischer Prägung mit seiner kurvigen Wegführung und den gelenkten Blicken auf malerische Naturszenerien, der im 18. Jahrhundert endlich die engen Fesseln der barocken Gartengestaltung sprengte und sie durch die Prinzipien von Natürlichkeit, Naturnähe und freiem Miteinander ersetzte.
Als Produkt der Aufklärung prägte den Landschaftsgarten ein Naturverständnis, das nicht auf Ausbeutung fußen wollte – kurz: ein von Menschenhand geschaffenes, irdisches Paradies, in dem die Natur als Gegenmodell zur starren Hierarchie städtischen Lebens fungierte.
Es war diese ideologische Überfrachtung, schreibt der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, Jahrgang 1947, der zuletzt Monografien zur Theorie des Bildakts, Michelangelo und dem Künstler als Verbrecher publizierte, die "die stilistische Differenz zwischen dem Landschafts- und Barockgarten zu einem epochalen Kulturkonflikt erhob".
Die "bipolare Frontstellung" zwischen den beiden Gartentypen, so Bredekamp, verschleierte alsbald die "inneren Widersprüche" des Landschaftsgartens, auch weil sie keinen klaren Blick mehr auf die "alternativen Formen des geometrischen Barockgartens" erlaubte.
Neuere Forschungen legen nahe, dass die Grenzen nicht so streng zu ziehen sind. Mit seinem schmalen Buch "Leibniz und die Revolution der Gartenkunst" legt es Bredekamp klar auf eine Revision der gängigen Gartenhistorie an.
Zum Beispielfall werden darin der Große Garten von Hannover-Herrenhausen und die Beteiligung von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) an dessen Entstehung. Denn Garten und Schloss von Herrenhausen, argumentiert Bredekamp, "widersetzen sich der Einordnung in die eingeschliffene Abfolge von Renaissance-, Barock- und Landschaftsgarten, und dies gilt entsprechend auch für Leibniz' Sicht auf den Garten", denn die "Linearität dieser Sequenz war von Beginn an ein Produkt der Ausblendungen sowie gezielten Gewichtungen des historischen Materials".
Bredekamp geht es darum, "diese Verkürzungen zurückzunehmen und damit der Gartengeschichte insgesamt eine neue Wendung zu geben".
Leibniz – Philosoph, Politiker, Historiker, Mathematiker, Physiker und einer der Vordenker der Aufklärung – ging 1676 als Bibliothekar nach Hannover und war über 30 Jahre lang an der Gestaltung und Planung des Gartens mitbeteiligt, wobei ihn vor allem technische Lösungsvorschläge für die Brunnen, Fontänen und Kanäle beschäftigten.
Wie Bredekamp zeigt, prägte die gestalterisch wie technisch herausfordernde Planung dieser Gartenanlagen Leibniz' Vorstellungen von Natur und Kunst. Zur Schlüsselszene wird eine Anekdote, in der eine Gruppe um Leibniz und die Kurfürstin eines Tages in den Gärten die Frage beleuchtet, dass kein einziges Blatt in Form und Struktur einem anderen vollkommen gleiche.
Die Blätter des Großen Gartens werden zum Ausgangspunkt für Leibniz' Prinzip der unendlichen Unterscheidbarkeit der Dinge. Der Barockgarten mit seinen strengen, symmetrischen Formen steht dieser Vielfalt nicht im Weg: "Im Detail entfaltet sich vielmehr eine freie Variabilität, die umso stärker wirkt, je mehr sie durch gerade Linien begrenzt wird."
Bredekamp zeigt eindrucksvoll, dass auch der barocke Garten als Ort der Freiheit und Individualität wahrgenommen werden konnte und sollte und durchaus kein Gegenbild der Moderne war: Die Botschaft des Barockgartens ist fortschrittlicher als ihr Ruf; und auch in Landschaftsgärten kann es sehr eng gesteckte Grenzen geben. Das ist äußerst erhellend.