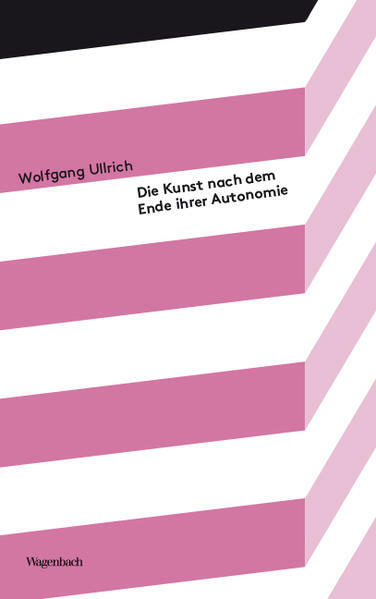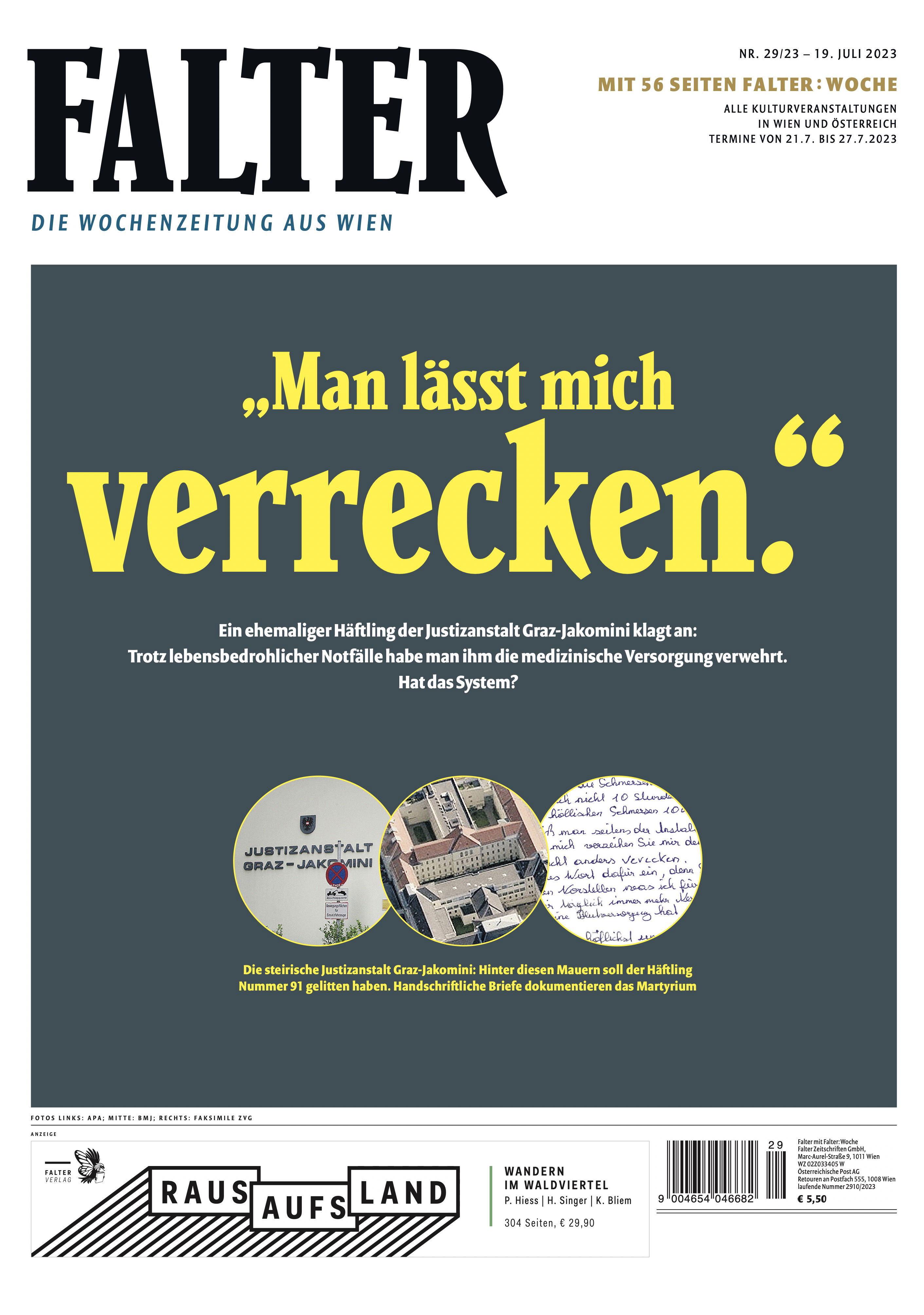
"Die Sehnsucht nach dem großen Künstler bleibt"
Matthias Dusini in FALTER 29/2023 vom 19.07.2023 (S. 24)
Der Publizist Wolfgang Ullrich gehört zu den besten Analytikern zeitgenössischer Kultur. In Büchern wie "Tiefer hängen" (2003) rückt er die Kunst in den größeren Zusammenhang von Konsum und Ökonomie. Mit eleganter Ironie durchleuchtet er die Mechanismen des Kunstmarktes und beschreibt Stars wie Jeff Koons als "Siegerkünstler". Ullrichs Essays beschäftigen sich auch mit digitaler Kultur, etwa mit Selfies in seinem 2019 erschienenen Buch gleichen Titels.
Im selben Jahr wurde Ullrich selbst zum Gegenstand einer Kontroverse. Nachdem er den bekannten deutschen Maler Neo Rauch eine rechte Gesinnung unterstellt hatte, porträtierte der Künstler Ullrich als mit Scheiße hantierenden "Anbräuner". Seit 2015 lebt Ullrich als freier Autor in Leipzig. Der Falter traf ihn anlässlich eines Vortrags im Wiener Schauspielhaus und sprach mit ihm über das Thema der Stunde.
Falter: Herr Ullrich, wenn künstliche Intelligenz mit zeitgenössischer Kunst oder Popmusik gefüttert wird, könnte sie zum Schluss kommen: Das kann ich auch. Liegt sie richtig?
Wolfgang Ullrich: Nachdem KI-Programme vor ungefähr einem Jahr viel präsenter geworden sind, habe ich mir bereits mehrfach in Ausstellungen gedacht, dass diese oder jene Bildidee oder -komposition von einem solchen Programm stammen könnte. Dieser Verdacht steht im Raum -und wird in den nächsten Jahren noch stärker werden.
Warum?
Ullrich: Gewisse Formen von Kunst werden in Legitimationsnöte geraten, paradoxerweise gerade auch einige, deren Urheberinnen und Urheber sich gar nicht für künstliche Intelligenz interessieren und daher nicht wissen, was da alles möglich ist. Wer etwa in der Tradition von Formen des Surrealismus oder des magischen Realismus steht, ist nun damit konfrontiert, dass viele KI-Bilder ganz ähnliche Kompositionen aufweisen. Umso wichtiger wird es werden, dass neue Werke auch eine künstlerische Intelligenz besitzen. Am besten liegt ihnen also ein klares Konzept zugrunde, zudem vielleicht auch ein politisches oder anderes Anliegen.
Was ist künstlerische Intelligenz?
Ullrich: Seit Jahren mache ich mir den Spaß, in Ausstellungen den IQ von Bildern zu messen. Künstlerische Intelligenz hat verschiedene Parameter -etwa wie ein Bildraum organisiert ist oder ob in dem Werk auf etwas Bezug genommen wird, das es in der Kunstgeschichte bereits gab. Oder ob einem Material ein bisher unbekannter Effekt entlockt wurde. Für mich ist es sehr wohl ein Kriterium für die Bewertung von Kunst, ob ich Intelligenz spüre.
"Das kann ich auch" war früher das Ressentiment gegen moderne Kunst.
Ullrich: Ist es immer noch, nur bekommt der Satz eine neue Volte. Bisher bezweckte er eine Entwertung, im Sinne von: Der andere ist genauso wenig Künstler wie ich. Wenn man jetzt sagt: "Das kann ich auch, und zwar mithilfe von KI", dann wird damit behauptet, dass das betreffende Werk bei einem Turing-Test (zur Distinktion zwischen Mensch und Maschine, Anm.) von KI-generierten Werken nicht zu unterscheiden ist.
Bei den Reaktionen auf KI fällt diese Verachtung auf. Es heißt etwa, sie würde nur blöd lernen und keine Seele besitzen. Warum sind die Menschen so gemein?
Ullrich: Manchmal ist das auch ein Pfeifen im Walde. Viele sind sich unsicher, was ihre eigenen Tätigkeiten betrifft. Das betrifft vor allem jene, die Gebrauchstexte und -bilder herstellen, etwa Illustratoren oder Hilfskräfte in Anwaltskanzleien. Das ist schon eine Art Kränkung: Das, was wir mit Stolz als Ausdruck unserer spezifischen menschlichen Intelligenz gesehen haben, müssen wir jetzt mit Computerprogrammen teilen. Daher der Versuch, die Angebote von KI abzuwehren und kleinzureden.
Es fällt auf, dass die Reaktionen vor allem in Europa herablassend sind. Warum?
Ullrich: Wir haben hier nach wie vor das Menschenbild eines starken Individuums, wollen daher auch Ausnahmefiguren sehen, die eine besondere Form der Begabung, um nicht zu sagen: Genialität, besitzen und sich dadurch von anderen unterscheiden. Wir wollen Menschen sehen, die etwas Besonderes leisten. Und die das nicht nur durch Fleiß, Nachahmung und Planerfüllung schaffen. Das stupide Trainieren und Optimieren, wie KI es macht, passt da nicht dazu. Wir hängen der Vorstellung an, dass alles Bedeutende etwas Originelles und Unerwartetes sein muss. Dieser westliche Individualismus kollidiert nun mit Eigenschaften, die KI-Programme aufweisen.
In China wird KI weniger diskriminiert.
Ullrich: Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Autonomie des Individuums dort weniger verklärt wird. Daher wird KI eher als Partner gesehen, mit dem man zusammenarbeiten und Aufgaben schneller lösen kann. Aber es wird sich auch hier durchsetzen, KI als Tool zu verwenden. Wie bei allen technischen Innovationen wird es einige Berufssparten schon heftig treffen.
An welche denken Sie?
Ullrich: Neben den schon genannten Branchen etwa auch an Webdesign oder an einige Sparten der Fotografie, etwa die in der Werbung und in Zeitungen oft verwendete stock photography.
Die Kunst hat immer mit neuer Technik experimentiert, etwa mit Fotografie oder Video. Warum reagiert man auf KI so misstrauisch?
Ullrich: Das war in der Vergangenheit bei anderen neuen Techniken genauso. Mich erinnern die aktuellen KI-Debatten an jene Kontroversen, die ab 1839, nach Erfindung der Fotografie, ausgetragen wurden. Manche haben der Fotografie jede Kunstwürde abgesprochen und die Bilder als tot und kalt beschrieben, so wie Kritiker es heute von KI-Bildern behaupten. Und auch damals gab es die Befürchtung, dass das neue Medium die Malerei ersetzen wird. Das aber ist nicht eingetreten, im Gegenteil: Die Fotografie hat der Malerei bestimmte, eher dokumentarische Aufgaben abgenommen und sie damit sogar ein Stück weit zu neuen Möglichkeiten befreit.
In Interviews mit Künstlern ist häufig zu lesen, KI sei nicht zu ästhetischen Brüchen imstande. Dass sie nur wiederkäue, aber nichts Neues erfinde. Was meinen die damit?
Ullrich: Darin zeigt sich, wie stark die Sehnsucht nach etwas Unerwartetem ist, das mit bisherigen Konventionen bricht. Das war in der Kunst schon immer wichtig, vor allem in der Moderne, als das Neue konstitutiv wurde. Wer einen Bruch erzeugt, bekommt die meiste Aufmerksamkeit. Ob KI das kann, muss sie erst beweisen. Was diese Programme allerdings gerade im Bereich der Kunst attraktiv macht, ist, dass sie nicht perfekt sind. Es passieren Glitches und Absurditäten. Die Finger und Bildräume stimmen oft nicht, doch damit sehen die Bilder nach Kunst aus. Radikale Brüche stehen allerdings noch aus.
Es heißt schon lange, dass die Medien den Menschen als Schöpfer ablösen, manche sprachen sogar vom Tod des Autors. Offenbar steht die KI-Debatte in einer langen Tradition.
Ullrich: Ich gebe Ihnen recht, dass wir gegenwärtig eine weitere Dekonstruktion von Autorschaft erleben. KI bestätigt all das, was Postmodernisten wie Jacques Derrida immer schon behaupteten: Es gibt keinen Ursprung und keinen Anfang und insofern im strengen Sinne auch keine Urheberschaft. Bilder und Texte entstehen bei KI-Programmen nur noch ersichtlicher als sonst aus bereits vorhandenen Bildern und Texten. Zugleich beobachte ich allerdings eine Entwicklung, die in eine ganz andere Richtung weist.
Und zwar?
Ullrich: Es gibt überraschenderweise plötzlich ein neues Verständnis für die Genietradition. Jene, die Bildprogramme nutzen und Prompts eingeben, machen eine merkwürdige Erfahrung. Sie stellen sich ein Bild vor, das sie sehen wollen, und tippen die Anweisungen ein. Dann bekommen sie von der KI mehrere Varianten ausgespuckt. Die meisten sind überrascht von dem, was die Maschine kann. Plötzlich wissen sie nicht, ob sie darauf stolz sein sollen: Ist das ihr Werk oder hat das gar nichts mit ihnen zu tun? Immerhin haben sie den Prompt formuliert und eine Variante ausgesucht. Sie sehen sich also als Medien dieses Programms. Und damit machen sie eine Erfahrung, die der alten Genieerfahrung nicht unähnlich ist.
Wie meinen Sie das?
Ullrich: Das Genie wurde in der Vormoderne auch als Medium begriffen. Es hätte nicht behauptet, selbst ein Meisterwerk gemalt zu haben, ja Urheber davon zu sein, sondern hätte sich als auserwählt von höheren Kräften bezeichnet. Durch das Genie hindurch haben Geister, eine Gottheit oder die Kräfte der Natur gewirkt und dieses Werk erzeugt. Das Genie war also auch selbst von dem überrascht, was es Großartiges hervorbringt. Eine ähnliche Konstellation wiederholt sich nun im Umgang mit KI.
So wie Psychedeliker LSD in den 1960er-Jahren nicht als Trübung, sondern als Erweiterung des Bewusstseins wahrgenommen haben.
Ullrich: Genau. Man will die eigene Intentionalität überlisten und hofft auf Zugänge zu anderen Quellen. Da war jemand, der in den 60er-Jahren mit Drogen experimentiert hat, nicht anders als Jahrhunderte vorher ein Genie, das an göttliche Eingebungen glaubte. Und eine ähnliche Erfahrung von Überwältigung macht heute jemand, der Prompts eintippt.
KI-Anwendungen wirft man vor, sie würde nichts Originelles kreieren. Aber so viel Spannendes passiert in den Museen, Theatern oder Konzertsälen im Vergleich dazu ja gar nicht. Wann kommt die nächste Revolution?
Ullrich: Für die Kunst gilt das, was der bekannte US-amerikanische Theoretiker und Autor Thomas S. Kuhn für die Wissenschaft herausgearbeitet hat. Die meiste Zeit läuft alles normal. Ab und zu gibt es eine Störung der Abläufe, die Kuhn als Paradigmenwechsel bezeichnet. Dann gibt es eine wissenschaftliche Revolution. Kuhn selbst hat sein Modell übrigens von der Kunstgeschichte übernommen. Er hat dort beobachtet, dass ein neues Medium, eine neue Gattung oder ein eminenter Künstler den Normalbetrieb mit einer bahnbrechenden Idee unterbricht.
Woran erkennt man einen Paradigmenwechsel?
Ullrich: Der wird meist erst im Rückblick erkannt, und zwar daran, wie viele Künstlerinnen und Künstler sich darauf berufen. Marcel Duchamp hat mit seinen Readymades die Kunst verändert. Er hat gezeigt, dass alles zu Kunst werden kann, wenn man es nur schafft, es in eine Kunstinstitution zu transferieren. Wie bahnbrechend das war, erkennen wir erst daran, dass es seit einem Jahrhundert tausende Varianten davon gibt und immer wieder etwas anderes transferiert wurde. Deswegen sind Phasen der Normalität, wie wir sie jetzt gerade erleben, wichtig. Das macht KI-Programme gerade auch interessant.
Inwiefern?
Ullrich: Indem sie reproduzieren, erkennen wir besser, was unsere Standards und ästhetischen Normen sind. Es gibt etwa bereits jetzt eine Debatte darüber, ob KI-Bilder rassistisch oder sexistisch seien. Das ist nachvollziehbar. Dabei greift KI lediglich jene Merkmale auf, die im bestehenden Bilderpool zu finden sind. Wenn da so viele rassistische Bilder drin sind, ist es auch kein Wunder, dass ein entsprechendes Bild dabei rauskommt. Durch KI haben wir die Chance, unsere eigene kulturelle Tradition besser zu verstehen.
Als Technikoptimist könnte man meinen, dass künstliche Intelligenz einen Paradigmenwechsel darstellt. Wie schätzen Sie das ein?
Ullrich: Auch das werden wir erst im Rückblick feststellen können. Auf jeden Fall aber werden durch die KI neue Unterscheidungen wichtig, vor allem kommt es zu Neubewertungen. Man wird manche Fähigkeiten gerade im Bereich der Kunst auf einmal viel mehr wertschätzen, als Ausdruck echter Kreativität feiern, anderes hingegen, das lange bewundert wurde, fortan langweilig finden -eben weil es von den KI-Programmen genauso gut gemacht werden kann. Auf diese Umwertungen bin ich gespannt, sie bringen viel Bewegung in den Diskurs.
Sebastian Kiefer in FALTER 29/2022 vom 20.07.2022 (S. 28)
Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich ist ein Sprachrohr des akademisierten Kunstpopulismus, für den überholt ist, wer zwischen hoher ("autonomer") Kunst sowie Konsum-und Popkultur Art-und Rangunterschiede sieht. Zeitgemäß sind danach nur Werke, die Gefühle von Gemeinschaften bebildern und sich durch gemeinsame Konsuminteressen, Feindbilder und Überzeugungen etwa zur Geschlechterordnung oder zum Umgang mit Migranten definieren.
Es ist die Welt der "Art Toys" und ihrer "Fan Communities". Gestylte Sneaker werden hier als Kunst vermarktet. Zur geistigen Höhenlage dieser Welt passt Ullrichs pseudotheoretischer Rahmen: Er scheint weder Geschichte noch Argumente des Gedankens des "autonomen" Werkes zu kennen und über die passagenweise Lektüre seines Lieblingsfeindes Adorno nicht hinausgekommen zu sein.