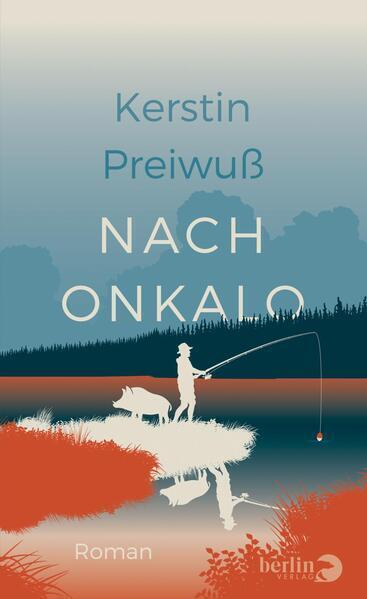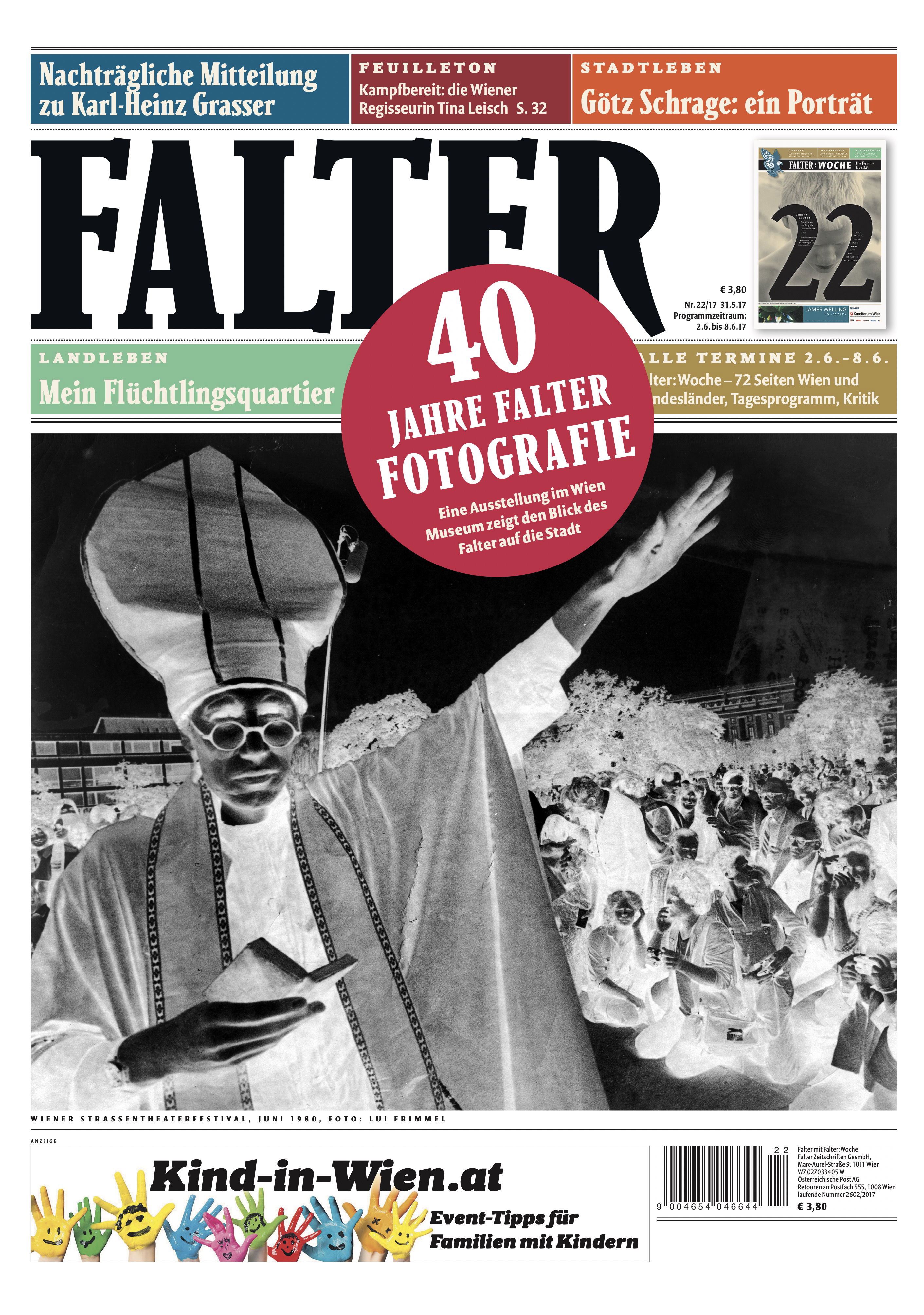
Schicht im Schacht
Klaus Nüchtern in FALTER 22/2017 vom 31.05.2017 (S. 37)
Die Arbeiterklasse hat wieder Saison, auch in der Literatur: Martin Becker und Kerstin Preiwuß begeben sich in ihren Romanen zu den Modernisierungsverlierern in die deutsche Provinz
Seit einiger Zeit ist eine Rückkehr der Arbeiterklasse zu beobachten. Von einem Erstarken der Arbeiterbewegung kann zwar keine Rede sein, aber zumindest als politische Projektionsfläche hat das Proletariat Konjunktur – und zwar meist in Gestalt von weißen, männlichen Modernisierungsverlierern aus darniederliegenden Industriegebieten, die aus Frust Donald Trump oder den Front national wählen. Die will man jetzt verstehen. Es ist also weiters nicht verwunderlich, dass sich Bücher wie Didier Eribons „Rückkehr nach Reims“ oder J.D. Vance’ „Hillbilly-Elegie“ eines großen Leserinteresses erfreuen.
Aber auch in der schönen Literatur scheinen die Abgehängten und Frühverbrauchten einer ehemals stolzen Klasse Konjunktur zu haben. Martin Beckers Roman „Marschmusik“ handelt von einer Rückkehr ins Herkunftsmilieu. Der Ort, an dem er spielt, Mündendorf, ist zwar fiktiv, aber angesichts all der ausgestreuten Autobiografie-Signale darf man dahinter wohl das sauerländische Plettenberg vermuten, aus dem der Autor, Jahrgang 1982, stammt.
Aufgewachsen in einem Mittelreihenhaus in einer Mittelstadt im Mittelgebirge hat sein Ich-Erzähler, so scheint’s, auch ein mittleres Schicksal ausgefasst: „[I]ch war nicht einsam, ich war nicht orientierungslos, ich stand, wie sagt man, mitten im Leben, ich wusste, was im Feuilleton zu lesen war, ich wusste, worüber man zu reden hatte in den Kreisen der sogenannten Intellektuellen, zu denen ich nie ganz gehörte.“
Hier tut sich eine – vom Erzähler selbst offenbar nicht bemerkte, jedenfalls weiters nicht thematisierte – Diskrepanz auf. Der junge Mann ist nämlich von Schwermut und unerklärlichen Ängsten gezeichnet, sodass er lieber auf einer Matratze im Kinderzimmer seines Neffen als im Haus seiner Kindheit nächtigt. Nach dem frühen Tod des Vaters und dem Auszug der beiden älteren Brüder, wird dieses nur noch von der Mutter bewohnt, die nun schon mehr als ein halbes Leben mit den Folgen eines cerebralen Aneurysmas zurechtkommen muss, das sie nur knapp überlebt hat.
Für den Leser stellt sich Mündendorf als ein dahinsiechendes Provinzkaff dar, der Protagonist vermag selbst dem Ausflug zu den Grabbeltischen der Einkaufsoase, wo er für die Mutter ein paar Schnäppchen ersteht, etwas abgewinnen: „Dieses Mündendorf ist, dabei bleibe ich, so paradox es klingt, ein wunderbarer Ort. Die Luft ist gut, die Talsperren sind nah, die Wälder unendlich, (…) das Ruhrgebiet und mit ihm Kultur und Zerstreuung nur einen Katzensprung entfernt.“
„Marschmusik“ ist von der Aggression und Verzweiflung, die hierzulande in den 1970er-Jahren die Heimatliteratur eines Gernot Wolfgruber kennzeichnete, ebenso weit entfernt wie von den blasmusikpopironischen Provinzverspaßungen jüngerer Zeit. Vielleicht erklärt sich die „Melancholie“ und „Herzschwere“, die der Ich-Erzähler an sich selbst konstatiert, auch daraus, dass er nicht Abschied nehmen kann von der Welt seiner Eltern und seiner Kindheit. Denn einerseits ist er dieser entkommen, andererseits mag er darüber nicht so recht froh werden, weil ihn das schlechte Gewissen plagt. Schon als Bub war ihm die Blasmusikkapelle, der er mit großem Enthusiasmus beigetreten war, nicht gut genug. Der überambitionierte Späteinsteiger träumt von einer völlig irrealen Karriere als Soloposaunist und lässt die Musik schließlich vollkommen sausen.
Die Annäherung an den wortkargen und fallweise jähzornigen, im Grunde aber herzensguten Vater findet posthum statt und kulminiert in einem Tagesausflug in die einige Male zu oft beschworene „Welt der Maloche“: Dank des Deus-ex-Machina-gleichen Wirkens des einzigen echten Freundes seines Vaters begibt sich der ängstliche, aber gute Sohn des einstigen Kohlenhauers ebenfalls untertags in den Schacht und hält schließlich glücklich ein Stück noch warmer Kohle in Händen, dass er mit Klarlack konservieren wird.
„Marschmusik“ ist eine anrührende, stellenweise auch kitschgefährdete Übung in Elternempathie, und die Szenen zwischen dem Sohn und dessen emotional ebenso erratischer wie unverstellter Mutter sind zugleich komisch und wahrhaft herzerwärmend.
Kerstin Preiwuß, Jahrgang 1980, stammt aus Mecklenburg und dort mag auch ihre, mit konkreten Ortsbezügen geizende Provinzgeschichte „Nach Onkalo“ angesiedelt sein. Der etwas kryptische und vielleicht nicht ganz glücklich gewählte Titel ist das finnische Wort für „Hohlraum“, spielt auf das Atommüllendlager auf der finnischen Insel Olkiluoto an und verdankt sich dem Umstand, dass Abriss- und Endzeitszenarien in diesem 230 Seiten schlanken Roman eine zusehends größer werdende Rolle spielen.
Der Protagonist, der mit allen, sogar sich selbst per „Matuschek“ zu sein scheint, lebt noch im Haus seiner Mutter, als ihm diese wegstirbt. Da ist er freilich schon ein recht unjunger 40-Jähriger: „Man ist so alt wie sein ältestes Organ, das wird dann wohl die Leber sein. Matuscheks jüngstes Organ ist sein Schwanz, aber der wird hier kaum gebraucht.“
Mit seinem sehr überschaubaren Freundeskreis erweist sich der Protagonist als einigermaßen verwahrlosungsgefährdet, zumal sein Nachbar, der von den Wohlstandsansprüchen seiner Frau gestresste Russe Igor, eines Tages im Flachwasser des Sees ertrinkt, und ein gewisser Witt, mit dem Matuschek die Passion des Brieftaubenzüchtens teilt, noch um ein Eckhaus eigenbrötlerischer ist als dieser.
Was sich zunächst als Provinzkomödie mit semisympathischen Losertypen anlässt, gewinnt zusehends bedrohliche, ja apokalyptische Züge. Die ziemlich unzimperliche Autorin versteht es blendend, zugleich Distanz zu wahren und sich ganz nahe an ihre Figuren heranzuschreiben, unmerklich aus der Außen- in die Innenperspektive zu wechseln. Sie mutet ihrem auch bald in die Arbeitslosigkeit entlassenen Helden einiges zu – etwa in der schockierenden Begegnung mit einem bis dahin verschwiegenen Sohn seiner russischen Kurzzeitgeliebten –, will diesem aber sichtlich auch wohl.
Ähnlich ihrer aus Ungarn stammenden Kollegin Terézia Mora, die zuletzt den grandiosen Erzählband „Die Liebe unter Aliens“ vorgelegt hat, verfügt Preiwuß über die hohe Tugend einer unsentimentalen Menschenfreundlichkeit. Ihre Protagonisten sind sichtlich nicht die Allerhellsten und gewiss ziemlich anstrengend, aber nie gerät die Anatomie männlicher Einsamkeit, die in „Nach Onkalo“ erstellt wird, zur zynischen Untergangsstudie à la Gebrüder Coen.
Als ein ziemlich zwielichtiger Typ namens Lewandowski, der selten zu Hause ist und sehr viele Pakete bekommt, ins Haus des verstorbenen Igor zieht, gerät Matuschek in eine nachbarliche Nähe, die ihm gar nicht recht ist und recht bald bedrohliche Ausmaße annimmt. Preiwuß’ Roman hat freilich so viel zu bieten, dass man eines ruhig verraten darf: Es geht nicht ganz schlimm aus. Gar nicht.