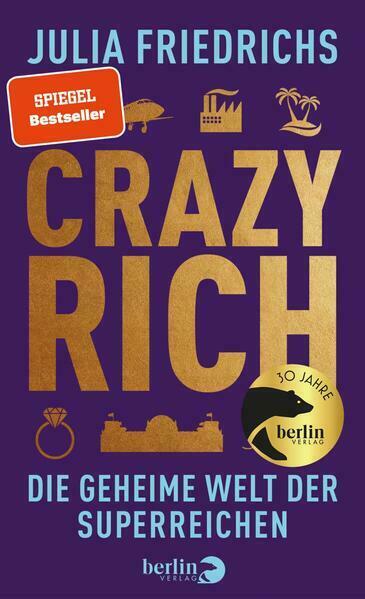" Superreiche sind sehr misstrauisch"
Barbaba Tóth in FALTER 22/2025 vom 28.05.2025 (S. 20)
Mit ihrem Buch "Crazy Rich" gelingt der Journalistin Julia Friedrichs ein seltener Blick hinter die Kulissen der Superreichen. Anders als der reißerische Titel verspricht, ist es eine sehr empathische Auseinandersetzung mit den Privilegien, aber auch Sorgen dieser Menschen.
Falter: Frau Friedrichs, wie kommt man als Journalistin auf das Thema Superreiche?
Julia Friedrichs: So abseitig ist es ja nicht, es ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz, welche Rolle Superreiche spielen. Das wird von der Politik nicht offen adressiert. Wir sprechen über Einkommen, aber wenig über Vermögen und schon gar nicht über die Umverteilung. Mir ging es nicht um Reiche, die einige Millionen haben, sondern um die wirklich Superreichen mit Vermögen im Wert von mehr als 100 Millionen, oft Milliarden. Das ist eine sehr verschlossene, geheime Welt und gleichzeitig eine von höchstem Interesse für uns alle.
Sie wollten also nicht einfach ein paar Monate Recherche auf Jachten und in Privatjets verbringen und dabei Champagner trinken
Friedrichs: Natürlich nicht, ich wollte aufklären - über einen Bereich unserer Gesellschaft, über den wir ganz wenig wissen. In Deutschland wissen wir nicht einmal, wer genau superreich ist. Es fehlen Daten und Zahlen über ihr tatsächliches Vermögen, sie werden von der Finanz, aber auch von der Wissenschaft, etwa der Soziologie, nur sehr selten erfasst. Und wenn, dann entziehen sie sich oft. Und das, obwohl Superreiche eine Gruppe mit großem politischem Einfluss sind.
Sie versuchen in Ihrem Buch durchaus, Verständnis für die Probleme dieser Menschen zu entwickeln, manchmal spürt man sogar Mitleid. Werden Superreiche in der Öffentlichkeit verzerrt dargestellt?
Friedrichs: Medien berichten sehr einseitig. Es sind entweder diese Erfolgsgeschichten, von Helden, die unserem Land Wohlstand bringen. Oder sie werden als maßlos, gierig, abgehoben dargestellt, als Menschen, die es am besten gar nicht geben sollte. Beides ist grundverkehrt, Menschen sind keine Schablonen, Karikaturen, es gibt immer einen Graubereich, Ambivalenzen. Das macht uns am Ende ja interessant, und genau das wollte ich für Superreiche ausloten. Wir reden hier über Persönlichkeiten und keine Abziehbilder.
Die Superreichen haben es Ihnen nicht leicht gemacht, sich ihnen anzunähern. Sie bekamen viele Absagen.
Friedrichs: Ja, sehr viele. Superreiche sind sehr misstrauisch, und sie sind überzeugt davon, dass ihr vieles Geld Privatsache ist und niemanden etwas angeht. Ich finde, das ist ein großer Irrtum. Es geht nicht darum, zu schauen, in welchen Häusern diese Menschen wohnen, was ihre Kinder machen -das wäre kein guter Journalismus. Sondern zu fragen: Was habt ihr denn mit diesem Geld vor, was sind eure gesellschaftlichen und poli tischen Überzeugungen, was wollt ihr mit diesem riesigen Hebel, der in euren Händen liegt -da haben wir schon ein Anrecht darauf, das zu erfahren.
Welche Absage hat Sie am meisten geärgert?
Friedrichs: Es gab zum Teil kuriose Absagen, die sicherlich kurioseste war die des Molkereibesitzers Theo Müller. Von dem bekam ich ein Paket mit einem Buch und einem Brief. Das Buch war ein sehr alter ökonomischer Schinken aus dem Jahr 1932, "Die Gemeinwirtschaft" des Wirtschaftswissenschaftlers Ludwig von Mises. Erst wenn ich dieses Buch gelesen und "verinnerlicht" hätte, stehe er bereit. Ich las es, meldete mich bei seinem Assistenten, wurde dann aber nur abgewimmelt.
Was wollte er Ihnen damit sagen?
Friedrichs: Das ist der Moment, in dem man sich fragt: Hat er nichts Besseres zu tun? Warum diese Art von Machtspiel? Er hätte ja auch einfach absagen können. Aber das habe ich bei vielen, die ich getroffen habe, in unterschiedlichem Ausmaß gespürt: Sehr reiche Menschen sind es gewohnt, alles um sich herum auf irgendeine Art kontrollieren zu können. Und viele erfüllen ihnen ihre Wünsche in vorauseilendem Gehorsam, weil sie mit ihnen unternehmerisch agieren wollen oder weil sie direkt von ihnen bezahlt werden. Der von mir sehr geschätzte Fußballer Marko Arnautović sagte einmal zu einem Polizisten, der ihn angehalten hatte: "Ich kann dein Leben kaufen." Das trifft die Grundhaltung von Superreichen ganz gut.
Einmal wurden Sie kurzfristig von einem Privatjetflug ausgeladen.
Friedrichs: Mein Kollege und ich waren mit dem Milliardär Hans-Peter Wild verabredet, der Erfinder von Capri-Sonne. Wir drehten eine TV-Doku über ihn. Wir sollten mit seinem Privatjet nach Paris, um dort ein Spiel seines Rugby-Klubs zu sehen. Alles war organisiert. Am Tag davor kam der Anruf. Jemand hatte ihn auf mein Buch "Wir Erben. Was Geld mit Menschen macht" aufmerksam gemacht. Es hat ihm nicht gefallen, er meinte, ich sei zu neidisch, und deshalb wollte er nicht mehr, dass ich mitfliege.
Sind Sie neidisch?
Friedrichs: Nein. Der Neidverdacht ist ein Totschlagargument gegen jede kritische Nachfrage. Natürlich gibt es Neid, aber wir neiden dem Nachbarn eher den Pool als Superreichen ihre Jacht, weil die Dimensionen ihres Vermögens unsere Vorstellungskraft übersteigen.
Gab es je ein Gespräch, das abgebrochen wurde?
Friedrichs: Nein, aber einmal war es fast so weit, als ich nach den Steuermodellen anderer Superreicher gefragt habe. Superreiche sind sehr damit beschäftigt, ihr Vermögen so anzulegen und auf der Welt zu verteilen, dass sie möglichst wenig Steuern zahlen. Aber natürlich reden sie darüber nur sehr ungern. "Wenn Sie nicht so nett wären, würde ich das Gespräch jetzt abbrechen", bekam ich zur Antwort. Ich verstehe schon. Es ist nicht einfach, sich mit Fragen auseinanderzusetzen wie: Finden Sie es in Ordnung, 500 Millionen geerbt zu haben, und andere müssen bei null beginnen? Deshalb bin ich auch voller Respekt vor allen, die sich mir gegenüber geöffnet haben. Der gegenseitige Austausch ist wichtig, um Verständnis füreinander zu schaffen. Weil Superreiche so abgeschottet leben, ist eine solche Konversation im normalen Leben nie möglich.
Was waren die Motive jener, die sich auf Gespräche mit Ihnen einließen?
Friedrichs: Unterschiedlich. Manche wollten etwas richtigstellen, ihr Image korrigieren. Andere hatten einfach Lust am Diskurs. Manchmal vielleicht auch Eitelkeit.
Stand René Benko auf Ihrer Liste?
Friedrichs: Nein, ich habe mich auf deutsche Superreiche konzentriert. Aber Benko war ein Meister darin, genau solche Menschen zu manipulieren. Man darf den Sinn für Wettbewerb unter Superreichen nicht unterschätzen. Es ist eben nicht egal, ob man drei oder vier Milliarden hat. Wenn da einer wie Benko kommt und hohe Rendite mit Immobilien verspricht, springen sie auf. Erst recht, wenn sie mitbekommen haben, dass ein anderer Superreicher schon an Bord ist und davon profitiert. Sie leben in einer sehr selbstbezogenen Welt, mit wenig Außenkontakt, aber viel Wissen über-und untereinander.
Welche Rolle spielen die Family-Offices, die die Vermögen Superreicher managen, dabei?
Friedrichs: Eine entscheidende. Family-Offices sind nicht nur Vermögensverwalter und quasi Kindermädchen für alles für Superreiche, sie verstehen sich auch als Lobbyisten ihrer Anliegen. In Deutschland gibt es die "Stiftung Familienunternehmen", das klingt nach einer Institution für Bäcker, Blumenhändler, Kfz-Werkstätten. Aber sie wurde von einigen der reichsten Familien gegründet. Die veröffentlichen natürlich jede Menge Studien gegen Erbschafts-und Vermögenssteuern, ähnlich wie die Agenda Austria in Österreich. Nachdem das Verfassungsgericht die Bevorzugung sehr reicher Erben bei der Erbschaftssteuer aufgehoben hatte, lieferte sich diese Stiftung eine große Lobbyschlacht. Mir haben Politiker erzählt, dass das das Intensivste war, was sie je erlebt haben. Ein Lobbyist bekam sogar am Sonntag vor der Entscheidung zur Erbschaftssteuer kurzfristig einen Termin bei Bayerns damaligem Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Für mehrere Stunden. So kurze Dienstwege gibt es sonst wohl eher selten. Ein Superreicher erzählte mir, dass Politiker von selbst bei ihm um Termine bitten.
Sie haben mit diesem einen Superreichen, den Sie im Buch "Sebastian" nennen, sehr ausführlich sprechen können. Er ist gar nicht glücklich über sein Erbe und will ein normales Leben führen.
Friedrichs: Dass jemand wirklich so hadert mit seinem Schicksal, superreich geboren zu sein, ist sicher kein Durchschnitt. Aber gerade unter jüngeren Erben ist er keine komplette Ausnahme mehr. Wir dürfen nicht vergessen: In eine superreiche Familie geboren zu sein, ist, wie ein Royal zu sein. Man muss sich der Dynastie fügen, eigene Lebensentwürfe sind nicht einfach.
Sie haben auch Marlene Engelhorn begleitet, die einen Bürgerrat ins Leben rief, damit dieser entscheiden soll, wie ein Teil ihres Erbes -25 Millionen - verteilt werden soll. Sie sahen diesen Prozess durchaus kritisch. Warum?
Friedrichs: Ich finde die Idee beeindruckend, radikal und beispielhaft. Aber in diesem Rat -Engelhorn nannten ihn "Guter Rat" - hatte zumindest ich, und ich glaube auch andere Reporter, die dabei waren, den Eindruck, dass am Ende der Einfluss der Moderatoren, der Organisatoren auf die Frage, wer das Geld bekommt, größer war, als man sich das anfangs gewünscht hatte. Es waren nur sechs Wochen Zeit, da brauchte es eine straffe Struktur, um zu Ergebnissen zu kommen. Viele Ansätze wurden nicht weiterverfolgt.
Die Organisatorin des Guten Rates hatte zuvor beim Momentum Institut gearbeitet, das am Ende auch eine große Spende bekam und zuvor schon von Engelhorn bedacht worden war. Eine schiefe Optik?
Friedrichs: Vielleicht wäre bei einer offeneren Debatte auch etwas ganz anderes entstanden. Eine "Gute Rat"-Stiftung, die Projekte fördert, zum Beispiel. So wurde das Geld rasch ein wenig nach Gießkannenprinzip an alle möglichen guten NGOs verteilt.
Welche Medien konsumieren eigentlich Superreiche?
Friedrichs: Unterschiedlich. Einer konsumierte sehr viele Live-Sportübertragungen, ein anderer bevorzugt die Wirtschaftsteile von Handelsblatt und Welt. Ein neues Phänomen ist, dass Superreiche eigene Medien-Outlets gründen, vor allem im rechtskonservativen bis rechtsreaktionären Bereich. Was früher der Fußballklub war, ist heute offenbar eine Onlineplattform. Bekanntestes deutsches Beispiel ist Frank Gotthardt, der das weit rechts außen stehende Nius finanziert.
Wie nahe stehen deutsche Superreiche generell das System ablehnenden oder libertären Parteien wie der Af D?
Friedrichs: Dazu gibt es leider nur anekdotische Evidenz. Die Angst oder Sorge unter Superreichen ist vorhanden, dass zahlreiche der "Ihren" in eine extrem rechte Richtung kippen. Das habe ich immer wieder mitbekommen. Dass man bei Tischgesellschaften dann Zeuge von Aussagen wird, wie dass die Demokratie eh nichts mehr bringe und Ähnliches. Das halte ich für eine große Gefahr. Denn wenn eine relevante Gruppe von Superreichen beschließt, wir rücken unsere Gesellschaft jetzt einmal in eine bestimmte Richtung, in die Richtung, die uns gefällt, dann hätten sie relativ große Chancen, dass ihnen das gelingt.