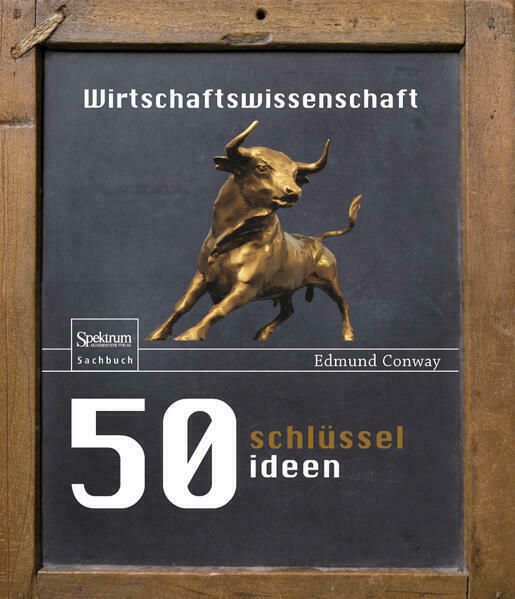Die Wirtschaft und die Frage nach dem Glück
Sebastian Kiefer in FALTER 17/2011 vom 27.04.2011 (S. 21)
Wer die Phillips-Kurve nicht kennt, ist reif für dieses hervorragende Einführungsbuch. Diese illustriert nämlich eines der ganz wenigen empirisch gesicherten Gesetze der Wirtschaftswissenschaften: die negative Korrelation von Inflation und Arbeitslosigkeit. Wenn man in freien Marktwirtschaften die Arbeitslosigkeit bei vier Prozent halten will, muss man sich mit einer Inflationsrate von sechs Prozent abfinden. Was das für Konjunktur und eine kapitalgedeckte Altersversorgung bedeutet, kann sich jeder leicht ausrechnen.
Wenn man die Marge der Europäischen Zentralbank befolgt und die Inflationsrate bei zwei Prozent halten will, muss man eine Arbeitslosenquote von sieben Prozent in Kauf nehmen. Das kann saisonal schwanken oder durch steuergeldfinanzierte Scheinanstellungen, Fortbildungen, Frühverrentungen, Bilanztricks verändert werden. Auf Dauer wird es sich wieder auf diesen Wert einpendeln – was einiges über die Kompetenz von Wirtschaftsministern sagt, die "Vollbeschäftigung" in Aussicht stellen.
Milton Friedman, Beelzebub des "Neoliberalismus", war einer der ganz wenigen, die aus der Phillips-Korrelation Konsequenzen zogen: Weil Arbeitslosigkeit systembedingt ist, sind Arbeitslose keine Almosenempfänger, sondern haben ein Anrecht auf automatische Versorgung.
Edmund Conway ist ein überaus talentierter Sachbuchautor. Auf engstem Raum führt er die grundlegenden Fragen und Modelle vor – vor allem die zahlreichen falschen und ideologischen "Patentlösungen" aus der Geschichte der Ökonomie.
Der Leser erfährt, weshalb die Globalisierung trotz allem enorm stabilisierend wirkt, warum man dem Bretton-Woods-System (das 1944 das Finanzsystem neu regelte) nicht vorbehaltlos nachtrauern soll; weshalb Protektionismus schädlich ist; was die Spieltheorie erklären kann und was nicht; weshalb eine moderne Ökonomie keine Gewinnmaximierungsmathematik sein kann, sondern ein "bunter Strauß" verschiedenster Wissenschaften, von Jura, Politologie bis zur Psychologie sein muss – wozu zuerst und zuletzt auch die Frage nach dem Glück gehört.