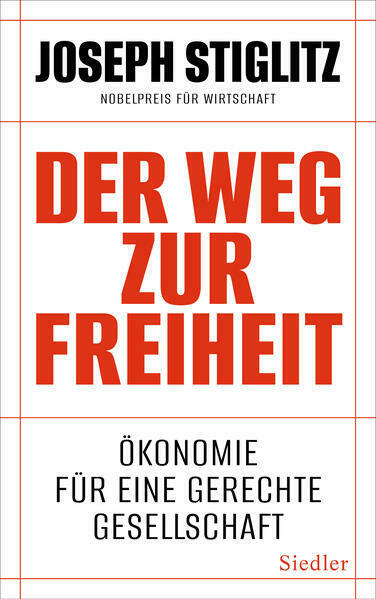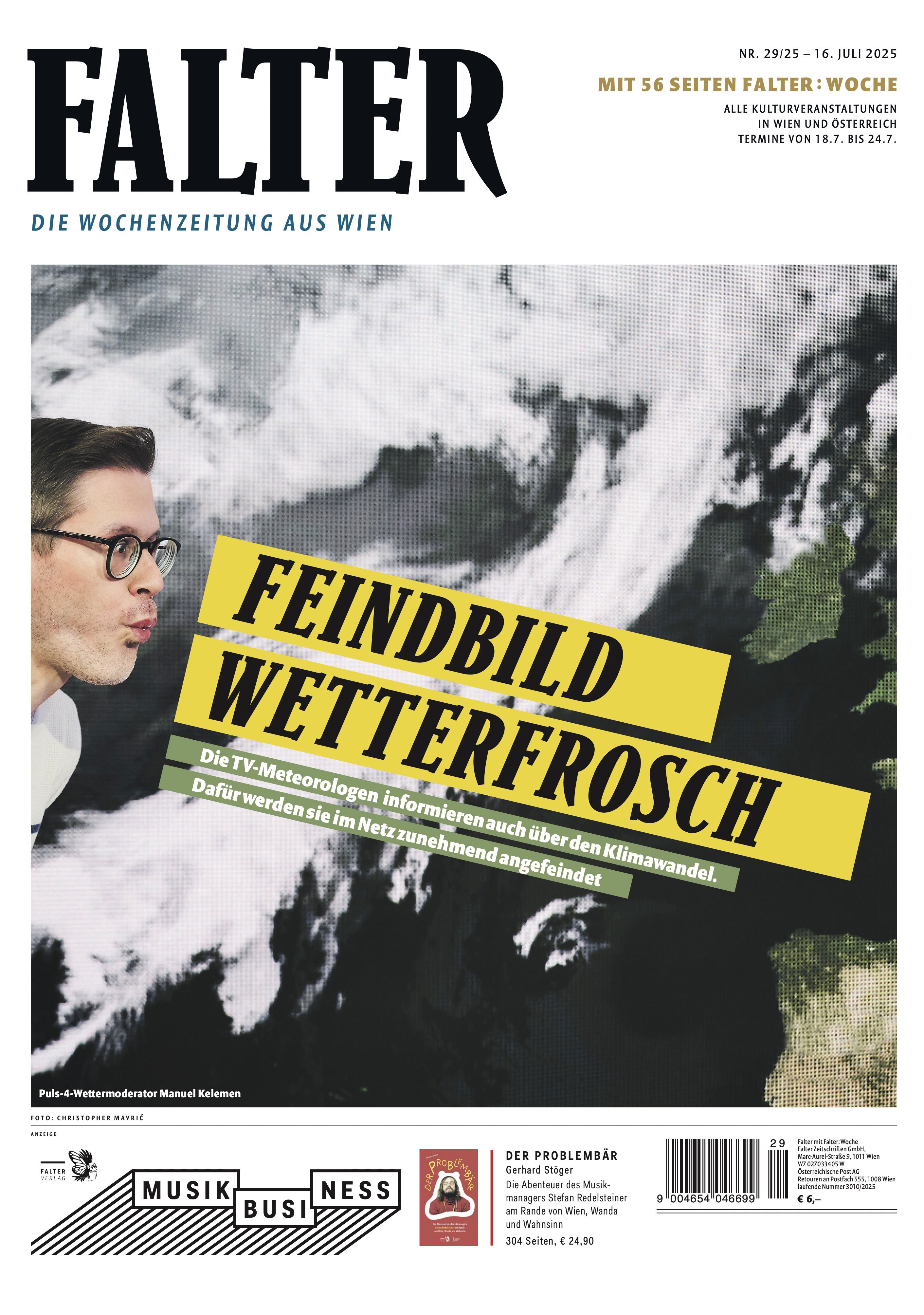
Beim Lunch mit Mr. Stiglitz
Lina Paulitsch in FALTER 29/2025 vom 16.07.2025 (S. 16)
Joseph Stiglitz hat lachende Augen. Vielleicht strahlt er deshalb eine gewisse Zuversicht aus, wenn er vor den katastrophalen Zuständen in seiner Heimat, den USA, warnt. 82 Jahre ist er alt, aber der Nobelpreisträger jettet immer noch um die Welt - etwa um sich über das Zoll-Drama von US-Präsident Donald Trump lustig zu machen. "Er ist einfach beleidigt, weil die Europäer keine benzinfressenden Ami-Schlitten wollen", erklärte er dem Falter im Juni in Tiflis.
Einst nannte man die Hauptstadt Georgiens das "Paris der Sowjetunion". Prächtige Bauten säumen breite Boulevards. In einem schick renovierten Industriebau befindet sich das Hotel Stamba. Meterweit hängen die Pflanzen in der Lobby herab, Bücherregale reichen hinauf bis in den zweiten Stock.
Joseph Stiglitz erscheint -gebückt, aber grinsend müht er sich die Treppe herunter. "Ich möchte georgisch essen", verkündet er. Stiglitz entscheidet sich für Satsivi, Huhn in Walnusssauce, ein traditionelles Gericht.
Den ganzen Sommer verbringt der US-Amerikaner in Europa. Gemeinsam mit seiner Frau, der Medienwissenschaftlerin Anya Schiffrin, ist Stiglitz als Stargast zu einem Journalismusfestival nach Tiflis gereist. Mitte Juni kamen hier Intellektuelle aus aller Welt zusammen, um über das autoritäre Zeitalter nachzudenken. Die Rechte, erklärte Stiglitz auf der Bühne, habe liberale Begriffe gekapert. "Freiheit" zum Beispiel.
Der frühere Chefökonom der Weltbank, später zum glamourösen Kritiker der Globalisierung avanciert, ist zum ersten Mal in die europäische Peripherie gereist. Unbeachtet von der Weltöffentlichkeit wehrt sich die 3,8 Millionen Einwohner zählende ehemalige Sowjetrepublik gegen den großen Nachbarn Russland. "Uns beeindruckt, wie stark die Solidarität hier mit der Ukraine ist", sagt Schiffrin, die wie ihr Mann an der renommierten Columbia University in Manhattan lehrt.
Was man in Georgien beobachten kann, ist nicht nur ein territorialer Konflikt, sondern vor allem auch ein Kulturkampf. Eine verweichlichte, links sozialisierte "woke" Minderheit führe Krieg gegen die wahren Interessen des Volkes -so lautet die Erzählung, die nicht nur Wladimir Putin vertritt, sondern wohl auch Donald Trump, der seit Wochen seine eigenen Universitäten attackiert.
"Vielleicht haben manche Aktivisten übertrieben", sagt Stiglitz, "aber jetzt haben wir eine Wokeness des anderen Extrems."
Über den Klimawandel zu sprechen, über Diversität und Gleichheit sei auf einmal tabu, bis zu 400 Professoren und Dozenten musste die Columbia auf Druck der Regierung entlassen. Trumps Angriff auf die freien Universitäten erinnert Stiglitz an die chinesische Kulturrevolution der 1960er-Jahre. Der kommunistische Diktator Mao Zedong vernichtete alles, was einen intellektuellen Anschein hatte. Er ließ Bücher verbrennen, Universitäten schließen - aber auch Millionen Menschen ermorden.
Für Trump muss nun die intellektuelle Elite als Sündenbock herhalten. Liberale Denker und alle, die seine Politik kritisieren, erklärt er zu Feinden.
Stiglitz formuliert es höflich, wenn er den US-Präsidenten als "außerordentlich unwissend in ökonomischen Fragen" bezeichnet. Trump stecke in den 1950er-Jahren fest. Er denke "nur an Güter und Autos, obwohl wir einen Handelsüberschuss bei Dienstleistungen haben". Die USA seien zu 90 Prozent eine Dienstleistungsökonomie. Noch nie, sagt Stiglitz, habe ein US-Präsident der Wirtschaft mehr geschadet.
Als junger Forscher bezeichnete sich Stiglitz als Zentrist. Im Lauf der Jahre rutschte er nach links. In den 1990er-Jahren diente er dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton als Wirtschaftsberater, für den progressiven Flügel der Partei wurde er zur Galionsfigur, die sich gegen die konservativen Republikaner im Kongress auflehnte. Stiglitz entwarf eine Philosophie des "Third Way", des dritten Weges, der freien Markt und staatliche Regulierung versöhnen sollte.
Damit machte sich Stiglitz nicht nur Freunde. Während Clinton ihn schätzte, rümpfte der damalige US-Finanzminister Lawrence Summers die Nase. Summers, dem Stiglitz' Kritik an der Liberalisierung des Welthandels zu weit ging, soll später für seinen Abgang bei der Weltbank eingetreten sein. 1997 wurde Stiglitz Chefökonom der internationalen Organisation, die Geld für Entwicklungshilfe verteilt. Weil er einen "Maulkorb" bekommen hätte, wie Stiglitz erklärte, legte er nur drei Jahre später sein Mandat zurück.
Stiglitz wuchs im Bundesstaat Indiana auf. Seine Mutter trichterte ihm die moralische Ambition ein. Wenn ihr Sohn fluchte, musste er sich den Mund mit Seife ausspülen. Zwar spielten Religion und Glaube für den Juden Stiglitz nie eine Rolle. Der elterliche Auftrag, "anderen zu Diensten" zu sein, etwas zu verändern, habe sich aber stets in seine Forschung gemischt, erzählt er.
Nach einem Studium der Mathematik schloss er ein Wirtschaftsstudium am Massachusetts Institute of Technologie (MIT) ab, wo er mit dem Keynesianismus in Berührung kam. John Maynard Keynes trat in den 1930ern als großer Gegner der freien Märkte auf, seine Theorie des "deficit spending" wurde Mainstream. Bis heute stützen sich Befürworter eines starken Staats auf seine Theorien. Als Stiglitz 1965 in Cambridge dissertierte, befasste er sich mit sozialer Gerechtigkeit, der ungleichen Verteilung von Einkommen und Vermögen. "Die gängigen ökonomischen Theorien haben soziale Probleme einfach geleugnet", sagt er heute.
Als "Kassandra der Finanzkrise", wie ihn die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal nannte, ging er später in die Geschichte ein.
Tatsächlich hatte Stiglitz vor jenem Zusammenbruch der Märkte gewarnt, der dann 2008 tatsächlich stattfand. Die klassische Ökonomie, so seine Kritik, messe dem "Informationsproblem" zu wenig Bedeutung bei. Stiglitz meinte damit ungleich verteilte Informationen -etwa, wenn Banken mehr über ihre Kreditnehmer wissen als umgekehrt. Das führe zu Misstrauen und Unsicherheit und letztlich in die Weltwirtschaftskrise. 2001 erhielt Stiglitz für seine Forschung den Wirtschaftsnobelpreis.
Im hippen Restaurant in Tiflis brummt laute Musik. Stiglitz muss sich konzentrieren, er überlegt lange, bevor er spricht. Heute, erklärt er, befänden wir uns im postneoliberalen Zeitalter. Ausgerechnet der Immobilientycoon Trump schieße gegen den Neoliberalismus. Trumps Schritte gegen den freien Welthandel, gegen Liberalisierung -Stiglitz hätte das einst befürwortet. Oder?
Nein, erklärt der Ökonom entschieden. Denn Trump stehe in der "schlimmsten Tradition" des amerikanischen Kapitalismus: profitgierig, aber abhängig vom Staat.
Den Kapitalismus habe immer eine Dissonanz zwischen Theorie und Praxis geprägt, sagt Stiglitz, "zwischen seiner Ideologie der freien Märkte und der korrupten Realität." Als "korrupt" bezeichnet er etwa Tech-Firmen, die öffentliches Geld einsacken und von steuerlichen Erleichterungen profitieren -aber zugleich den Staat als gieriges Monster diskreditieren. Auch Trump habe seit jeher den Staat für Sonderdeals genutzt. Die Theorie des Neoliberalismus diente ihm als Fassade, die er nun offenherzig abträgt.
Dass Trump keine Globalisierungskritik betreibe, zeige seine Zollpolitik, sagt Stiglitz. Mit Zöllen kanalisiere Trump amerikanische Emotionen. Er sehe Handelsdefizite - wenn die Importe die Exporte übersteigen -als Zeichen unfairer Behandlung, obwohl sie viel mehr mit makroökonomischer Politik zu tun haben. "Wir sparen weniger, als wir investieren -das führt zu Kapitalzuflüssen und damit zu Handelsdefiziten."
Später an diesem Tag wird Stiglitz auf der Festivalbühne sitzen, in einer Halle außerhalb des Stadtzentrums. Vor hunderten Besuchern spricht er zu seinem aktuellen Lieblingsthema. "Der Weg zur Freiheit" heißt sein jüngstes Buch, das im Mai auf Deutsch erschienen ist. Auf 475 Seiten breitet Stiglitz sein zentrales Argument aus, das der Philosoph Isaiah Berlin einmal so formulierte: "Die Freiheit der Wölfe bedeutete oft den Tod der Schafe."
Stiglitz' Freiheitsbegriff ist nicht neu. Er betont den Wert der positiven Freiheit, der jenen der negativen übersteige. Anstatt von etwas frei zu sein -etwa von Zwängen und Sorgen -, sei es wichtiger, frei zu etwas zu sein. Einen bestimmten Job zu wählen, etwa. Der Staat solle dafür die Voraussetzungen schaffen, schreibt Stiglitz, und mehr Regeln einführen, anstatt sie abzuschaffen. Die Marktwirtschaft sei zu regulieren und die "checks and balances", also die Gewaltenteilung, zu stärken.
"Wir haben geglaubt, so etwas könne bei uns nie passieren", warnt Stiglitz auf der Bühne und meint die Erosion der Demokratie in seinem Land. "Niemand ahnte, dass Trump so schnell so viele Gesetze missachten würde." Immerhin biete die Krise nun die Chance, den Rechtsstaat auf seine Schwachstellen hin zu überprüfen.
Für die Georgier mag das bitter klingen. Sie spüren Trumps zweite Amtszeit am eigenen Leibe. Die meisten georgischen NGOs und unabhängigen Medien sind auf US-amerikanische Gelder angewiesen, um zu überleben. Seit 1992 kamen allein über USAID, das größte staatliche Auslandshilfsprogramm der USA, mehr als 1,9 Milliarden Dollar ins Land. Als eine seiner ersten Amtshandlungen schaltete der Präsident USAID ab. Mit fatalen Folgen, warnt der ehemalige Weltbank-Ökonom.
"USAID hat viel bewirkt", sagt Stiglitz, "man denke an die Aids-Programme in Afrika." Nicht politischer Einfluss stand im Vordergrund, sondern Humanismus und Idealismus. Demokratien als Bündnispartner zu fördern, das entsprang einem amerikanischen Selbstverständnis. Auch Europa kam bekanntlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit US-Geld wieder in Schwung.
Jetzt, warnt Stiglitz, kämen auf jene Länder harte Zeiten zu, die sich gegen autoritäre Kräfte wehren. Europa und seine Peripherie seien nun auf sich selbst gestellt - und gefordert.
Obwohl die neoliberalen Diktate der 80er-Jahre nicht mehr gelten, sieht Stiglitz noch kein neues Zeitalter gekommen. Es fehle eine Philosophie, ein "set of rules". Von alternativen Staatsmodellen, wie sie dem Silicon Valley vorschweben, will der Ökonom nichts wissen: "Zu viel Macht in zu wenigen Händen ist gefährlich."
Auch in hohem Alter wird Stiglitz die Demokratie verteidigen. Und seinen Schalk im Nacken nicht verlieren.