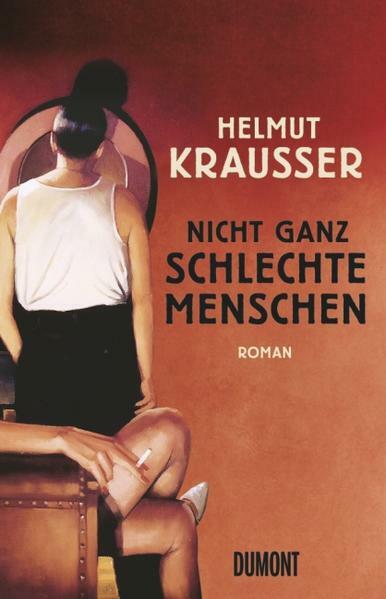Angenehme Bettwärme geht vor
Stefan Ender in FALTER 41/2012 vom 10.10.2012 (S. 10)
Helmut Kraussers "Nicht ganz schlechte Menschen" fahren in den 1930ern von Berlin über Paris bis Barcelona
Es wird angenehm viel nebeneinandergelegen und miteinander verkehrt in diesem Roman. Gleich zu Beginn erleben wir hierbei Amtsgerichtsrat Loewe, zwar glücklich verheiratet mit seiner Frau Hedwig, aber dennoch auch ein regelmäßiges Nahverhältnis mit seinen zwei weiblichen Angestellten unterhaltend. "Von beiden machte Theodor Loewe körperlichen Gebrauch", formuliert es Helmut Krausser – und zwar an den ungeraden Tagen vom Zimmer- und an den geraden vom Kindermädchen. Die Gattin ficht dies nicht sonderlich an, als Folge eines ehelichen Beischlafs gebiert sie dem preußischen Richter an einem Februar des Jahres 1915 Zwillinge, die Buben Max und Karl.
Bei den zwei Protagonisten des Romans zeigen sich mit den Jahren gegensätzliche Anlagen. Körperliche Eigenschaften mit ihren geistigen Interessen konterkarierend, beschreibt Krausser Karl als Menschen mit pyknischer Physis, wilden Locken und großem Appetit, der sich nach einem kurzen Interesse für den Schachsport vor allem dem Kommunismus verschreibt. Karl lebt in sexueller Grenzaskese.
Der dünne, blasse, schweigsame Max hingegen, eine "Schiele-Existenz", wird von einem Erzieher im Jesuitenkolleg schon früh auf die Freuden der Fleischlichkeit hingewiesen und liebt in weiterer Lebensfolge Männer wie Frauen sonder Zahl, Rennbahnen und Bordellbesuche. Die Mutter stirbt früh, der Tod des Vaters fällt in etwa mit der Reifeprüfung von Max und Karl zusammen. Die beiden ungleichen Brüder treten ein einigermaßen komfortables Erbe an. Das Romanleben, es kann kommen.
Der deutsche Schriftsteller Helmut Krausser, 1964 in Esslingen am Neckar geboren und in München aufgewachsen, zeigt in seinem umfangreichen Romanschaffen eine Neigung zu lustvollen, groß angelegten Streifzügen in die Vergangenheit, zu bunt gezeichneten Zeit- und Gesellschaftspanoramen. Konnte man sich in seinem 864-Seiten-Wälzer "Melodien" (1993) etwa an der Seite eines Alchemisten und Magiers nicht nur auf die Suche nach der Urmusik, sondern auch auf die Reise durch die Musikgeschichte der Spätrenaissance machen, so schilderte er in "Eros" (2004) die bundesdeutschen Nachkriegsjahrzehnte parallel zu den Liebesobsessionen eines steinreichen Industriellensohns.
So wie die NZZ Krausser mal als "chronisch uneingelöste Hoffnung der Gegenwartsliteratur" beschrieb ("Thanatos", 1996),
mal als "literarischen Glücksfall" ("Die wilden Hunde von Pompeii", 2004), so bemäkelte die Kritik allgemein seine wilden Achterbahnfahrten zwischen qualitativem Hui und Pfui sowie, seinen Stil betreffend, eine Mischung aus Gestelztheit und Trivialität.
Panoramahaft angelegt ist auch sein jüngster Roman, wenn sich "Nicht ganz schlechte Menschen" auch auf eine für Krausser verhältnismäßig knapp dimensionierte Zeitspanne fokussiert: die 1930er-Jahre. Doch in dieser Zeit ist in Europa bekanntlich einiges passiert, und so lässt Krausser die gut bemittelten Waisen Max und Karl erst einmal in Berlin studieren, was ihm Gelegenheit gibt, sowohl das pulsierende Nachtleben der Stadt als auch die ideologischen Kämpfe dieser Zeit sowie das Erstarken und die Machtergreifung der Nazis zu schildern.
Im Januar 1935 fliehen Max und Karl mit Ellie, Max' großer Liebe, im Nachtzug nach Paris. Karl stellt sich der hauptstädtischen Bevölkerung als Schach-, Max als Sexualpartner zur Verfügung, beide entgeltlich; und auch Ellie bessert das Haushaltseinkommen des Trios mit vornehmlich in horizontaler Lage getätigten Dienstleistungen auf.
Eine "Affäre" Ellies wird für die drei mit Fortdauer ihres fiktionalen Lebens zum neuen Ankerpunkt: Der vermögende Elsässer Pierre Geising, Besitzer eines Hotels an der Gare du Nord, bietet Ellie, Max und Karl Unterkunft, Unterstützung und Freundschaft an, wenn er auch über das Verhältnis zwischen Ellie und Max falsch unterrichtet wird.
Die Zeit des Trios in Paris nützt Krausser für ein amüsantes, wenn auch etwas pauschal gezeichnetes Porträt der von Emigranten bevölkerten Stadt. Dem Lebemann und Möchtegernschriftsteller Max spendiert er kurze Treffen mit Klaus Mann und Alfred Döblin, Joseph Roth stirbt leider kurz zuvor.
Die Achse Berlin-Paris wird sodann nach Barcelona verlängert, als Karl kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs (als Schachspieler) zur Volksolympiade fährt. Dort angekommen, weiß sich der etwas unfitte, auch zu gewöhnlicher körperlicher Arbeit wenig gewillte Geistesmensch kaum in die Kämpfe zwischen den Republikanern und den Franquisten zu integrieren. Immerhin nutzt Krausser den Aufenthalt zu einem Abriss über die Vorgänge während des (Stellvertreter-)Kriegs der politischen Systeme auf der Iberischen Halbinsel sowie zur Einführung einer zum Anarchisch-Enigmatischen tendierenden Figur (Zanoussi). Diese wird im letzten Teil gute Dienste leisten, wenn sich der Roman zum Krimi wandelt.
Krausser hat ein unterhaltsames, wohltuendes Buch geschrieben. Witz, Leichtigkeit und eine angenehme Bettwärme zeichnen es aus. Man darf hier kein scharf gezeichnetes, Politik und Gesellschaft analysierendes Großporträt jener Zeit erwarten. Des
Rapports rudimentärer historischer Fakten entledigt sich Krausser mittels different gesetzter pseudolexikalischer Einschübe auf eher lustlose, pflichtschuldige Art und Weise.
Die Stärke des Buchs ist seine Leichtgewichtigkeit, die Beschreibung des Lebens als eine Folge von Unwägbarkeiten. Reagiert man auf diese mit der Geschmeidigkeit einer Katze – zu lernen beim umtriebigen Max -, so landet man selbst bei tieferen Stürzen immer wieder auf den Pfoten, fallweise sogar im Honigtopf. Ende gut, alles gut? Denkste. Opernfan Krausser finalisiert seinen fast luftig-leichten Reigen in diesem sich rapide verdüsternden Jahrzehnt mit einem Paukenschlag.