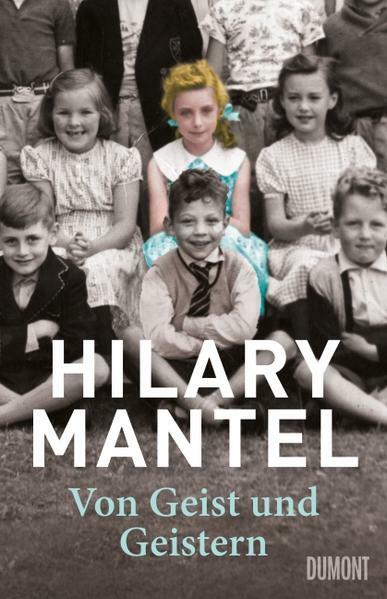Was ist schlimmer, Geist oder Gespenst?
Sigrid Löffler in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 14)
John Burnside und Hillary Mantel zehren in ihren abgründigen Romanen von der eigenen Wahnerfahrung
Grundsätzlich gilt, dass es Geister gibt, weil Menschen ständig berichten, dass sie Geister sehen.“ Niemand, der englische Gegenwartsromane liest, wird diesen Satz, auf den der britische Geisterforscher Roger Clarke seine ganze wunderliche „Naturgeschichte der Gespenster“ aufbaut, von der Hand weisen können. Laut Clarke ist die literarische Geistergeschichte „Englands großes Geschenk an die Welt“.
Stimmt. Und die besten Geistergeschichten von heute stammen von Hilary Mantel und John Burnside. Neben ihrem Ruhm und ihrem internationalen Erfolg haben die englische Autorin irischer Abstammung und der schottische Erzähler vor allem dies miteinander gemein: Sie sehen Gespenster und schreiben darüber. Sie sehen Wesenheiten von unklarem Realitätsstatus in der wirklichen Welt ihr Unwesen treiben. Jenseits des rational Wahrnehmbaren erscheint ihnen diese als durchlässig für die Sphären des Unerklärlichen und Dämonischen, und beide entwerfen eindringliche Bilder aus den Wahnwelten eines schwarzen, bösen und geisteskranken Britannien. Ihre Grundfrage lautet: Was ist normal? Was ist verrückt? Was gilt als gesellschaftliche Norm, was als Abweichung? Und wo verläuft die Grenze dazwischen?
Das Sinistre und dessen Ausgeburten kennen beide Autoren aus eigener Erfahrung. Aus den schlimmsten Phasen ihres eigenen Lebens wissen sie, wie man sich im Vollbesitz des eigenen Wahns fühlt. Ihre jeweilige Krankengeschichte, verbunden mit dem Konsum härtester Psychodrogen, liegt ihren literarischen Berichten aus der Welt der Phantasmagorien zugrunde und beglaubigt diese.
Hilary Mantel litt schon als Kind an schweren Migräneattacken, wodurch sich ihre Weltwahrnehmung eigentümlich verschob. In ihrer Autobiografie „Von Geist und Geistern“ berichtet sie, wie sie mit sieben Jahren den leibhaftigen Teufel im Garten stehen sah. Später wurde sie durch die Fehlbehandlung ihrer Ärzte mit Psychopharmaka fast in den Wahnsinn getrieben.
Solchem Mix aus migräneerleuchteter Hellsicht und psychogenen Wahnzuständen verdanken vor allem Mantels frühe Romane ihre nicht geheure Aura, ehe die Autorin dann völlig ins Genre des historischen Romans wechselte und Weltbestseller über die Zeit des Tudor-Königs Heinrich VIII. schrieb.
Das beste Beispiel für Mantels literarische Wahnweltphase ist das rabenschwarze, bösartige Romanduo „Jeder Tag ist Muttertag“ und „Im Vollbesitz des eigenen Wahns“, mit dem Mantel vor 30 Jahren debütierte und das nun erstmals auf Deutsch vorliegt.
Anders verlaufen ist die Drogenvita von John Burnside. Der Sohn aus schottischer Bergarbeiterfamilie war schon von frühen Teenagertagen an eine Suchtpersönlichkeit. Zehn Jahre lang stürzte er sich besinnungslos in den wüstesten Drogen- und Alkoholmissbrauch, der durch psychotische Schübe, eines schizophrenen Verknüpfungs- und Bedeutungswahns, noch verstärkt wurde.
Burnsides zweibändiger autobiografischer Roman „Lügen über meinen Vater“ und „Wie alle anderen“ führt zurück in dessen finstere Kindheit im Kohlerevier und in die Kämpfe mit seinem Unhold von Vater, einem Säufer, Gewalttäter und zwanghaften Lügner. Vor allem aber geht es in beiden Bänden um die vergeudeten Jahre der Selbstzerstörung. Im Irrenhaus erscheinen ihm die Gestalten des eigenen Wahns realer als die Krankenschwestern, die ihm ihrerseits wie Gespenster vorkommen. Danach nimmt er sein Selbstrettungsprogramm in die eigenen Hände und versucht, sich in Untermietzimmern in englischen Vorstädten allein in die Normalität zurückkämpfen – ein Projekt, mit dem er glorios scheitert, das ihn aber dennoch aus der Hölle seiner Phantasmen befreit.
„Surbiton“ lautet das magische Schlüsselwort für Burnsides geplante Flucht aus der Sphäre der Wahnvorstellungen in die reale Welt: „Das war es, was ich wollte: ein normales Leben, nüchtern, frei von Drogen, von Träumen, mit einträglicher Arbeit. Wie alle anderen wollte ich sein, ein Hausbesitzer, Steuerzahler, ein Name im Wahlregister, ein Nachbar von nebenan. Ich wollte die Ordnung eines normalen Lebens – in Surbiton oder einer ähnlichen Gegend. Also zog ich in die Vorstadt.“
Der Plan entpuppt sich als „perfekt, aber lächerlich“: Burnside muss erkennen, dass ein flaues Suburbia-Leben von neun bis fünf, mit Tee, Büroarbeit, Heckeschneiden und Kreuzworträtsel, nur eine andere Art von Betäubung darstellt. Die Rückfälle waren vorprogrammiert. Erst als er es schafft, seine Sucht aufs Schreiben umzupolen, kann er seiner Dämonen Herr werden. Jetzt treiben sie in seinen sinistren Mystery Novels ihr Unwesen, jedoch in literarische Form gebannt von ihrem Autor. Wobei der Experte Burnside Wert legt auf den Unterschied zwischen Geistern und Gespenstern: „Gespenster kann man abweisen, doch Geister sind immer bei uns. Letzten Endes sind Gespenster machtlos, Geister aber nähren unsere Fantasie und sind zu allem fähig.“
Von Geistern, die zu allem fähig sind, erzählt auch Hilary Mantel. Ihre ersten beiden Romane offenbaren ihren tiefschwarzen Humor, gespeist aus einem bösen Blick auf die so genannte Alltagsnormalität und einem wachen Sinn für das Irrationale und Abgründige, das dahinter rumort. „Jeder Tag ist Muttertag“ und „Im Vollbesitz des eigenen Wahns“ oszillieren zwischen Sozialsatire und Wahnwelt, zwischen Küchenrealismus und Gespensterspuk. Im Mittelpunkt stehen Mutter und Tochter Axon, die in ihrem verwahrlosten Haus in einer nordenglischen Provinzstadt, das sie voll von Dämonen, Untoten und Poltergeistern wähnen, an ihrer sozialen Verelendung arbeiten. Hilary Mantel lässt bewusst in der Schwebe, welche der beiden verrückter ist, die Mutter oder die Tochter. Der Wahn hält jedenfalls beide aneinander gefesselt.
Tochter Muriel ist das geheime Kraftzentrum beider Romane. Offen bleibt, wie Muriel zu deuten ist: Als Verrückte? Geisteskranke? Psychopathin? Böser Geist? Wechselbalg? Als eine Allegorie der Unangepassten, Ungezähmten und Außenseiter in der Gesellschaft? So viel scheint klar: dass sich im Hause Axon das Böse manifestiert – das Chaos.
In „Jeder Tag ist Muttertag“ passieren zwei Morde, die unerkannt und ungeahndet bleiben. Am Ende waren die Mutter und das neugeborene Kind von Muriel tot. Im Folgeroman „Im Vollbesitz des eigenen Wahns“ begegnen wir Muriel erneut, ebenso dem übrigen Personal des ersten Romans, nur elf Jahre später und zum Teil in neuen Konstellationen. Es ist 1984, das ominöse Jahr Orwells.
Aus der Psychiatrie entlassen, kehrt Muriel unerkannt in ihr früheres Biotop zurück, um Rache zu nehmen – nicht nur für den Tod ihres Kindes und nicht nur an dem alten Lüstling, der sie damals geschwängert hat. Als heimtückische Zerstörerin schleicht sie sich in das Leben der Kleinstadtbewohner ein, legt sich als Racheengel zwei verschiedene Identitäten zu.
Wie schlau und hinterhältig Muriel dabei zu Werke geht, macht den größten Reiz des Romans aus. Hilary Mantel hat ein grimmiges Vergnügen daran, Muriels doppelte Intrige als kompliziertes, feinmechanisch virtuos ausgetüfteltes Ränkespiel zu entwickeln. Der Leser sieht sich unversehens zum Komplizen von Muriels Perfidie gemacht und von der Autorin zu gemeinem Gelächter angestiftet. Das macht den Roman so unausstehlich unterhaltsam und auf garstige Weise lustig. Wobei als Kriechstrom unter der slapstickhaften Handlung immer die ernste Frage mitläuft: Wer ist normal? Wer ist verrückt?
Bei Mantel ist so gut wie jede Romanfigur im Vollbesitz des eigenen Wahns, die sogenannten Normalen ebenso wie die Irren und die Psychopathen. Wo die Grenze dazwischen verläuft, ist nicht erkennbar. Und dieser Realitätsschwindel ist der vielleicht alarmierendste Aspekt dieses brillant unguten Romans.